Eine Weltreise in Berlin und Potsdam
Lesezeit ca. 83 Minuten
01 Sehnsucht nach Exotik
Das Adjektiv exotisch, abgeleitet vom griechischen εξωτική (exotikí = die „auswärtige“, „fremdländische“ Sache), kam übers lateinische exoticus, (der Ausländische) in unsere Sprache und charakterisiert Personen, Länder, Pflanzen und Sachverhalte, die uns fremdartig oder außergewöhnlich vorkommen. Das Wort „exotisch“ impliziert, dass diesem Fremdartigen etwas Geheimnisvolles eigen ist, dass es einen gewissen Zauber ausstrahlt und uns dadurch fasziniert und anzieht. Diese Anziehungskraft bewirkte, dass zu allen Zeiten Menschen in fremde Länder aufbrachen um den Reiz des Exotischen kennen zu lernen. Selbstverständlich war auch die menschliche Gewinnsucht ein Motiv, das die – besonders in alten Zeiten – mühevolle und riskante Kontaktaufnahme mit exotischen Ländern begünstigte.
Die erste detaillierte Schilderung einer antiken Reise in ein exotisches Land finden wir im Totentempel der Königin Hatschepsut (18. Dynastie) in Deir el-Bahari, wo ein Relief eine Expedition ins Goldland Punt zeigt. Reisen nach Punt gab es aber schon vor Hatschepsut, unter Sahure (5. Dynastie) und Mentuhotep (11. Dynastie) – vor mehr als 3500 Jahren! Hatschepsuts Nachfolger Thutmosis eroberte Punt und auch unter Ramses III. (20. Dynastie) gab es weitere Punt-Expeditionen, auf denen exotische Güter wie Weihrauch, Ebenholz, Elfenbein, Gold, Augenschminke, Silber, Speisesalz, Affen, Hunde, Pantherfelle sowie Straußenfedern und -eier nach Ägypten gebracht wurden. Punt genau zu lokalisieren fällt den Archäologen schwer, am wahrscheinlichsten erscheint die Gegend am Roten Meer bis hin zum Horn von Afrika.
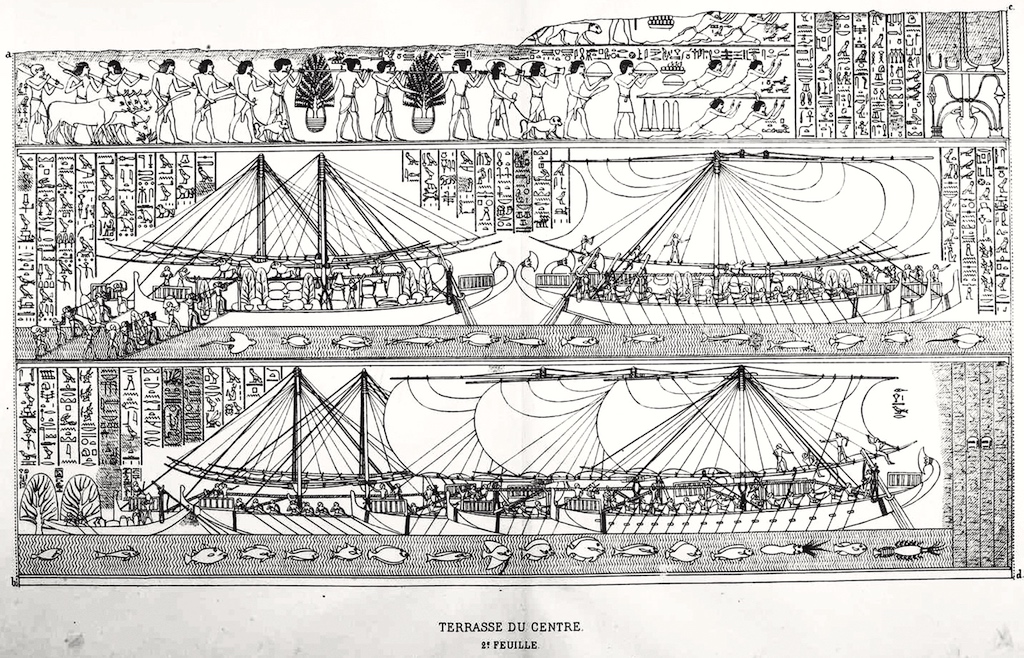
Ein weiterer berühmter Reisebericht in ein exotisches Land ist der über den phönizischen Admiral Hanno, der auf der Suche nach Gold die afrikanische Küste südwärts bis zum Golf von Guinea ruderte, dann aber auf Grund von Widrigkeiten umdrehen musste. Die in dem Bericht gegebenen geographischen Details lassen die Reise glaubhaft erscheinen, obwohl der Text nur einer Quellenabschrift des 9. Jh. n. Chr. entstammt. Dagegen ist die von Herodot geschilderte Umschiffung Afrikas durch ebenfalls phönizische Seeleute wohl eher Fiktion.

Mit der Etablierung des Imperium Romanum wurden exotische Länder Teil desselben und Reisen dorthin zur Gewohnheit. Dennoch behielten die fernen Länder ihren exotischen Charakter und viele römische Kaiser holten die Exotik nach Rom, indem sie für Zirkusspiele hunderte von exotischen Tieren wie Löwen, Tiger, Panther, Elefanten herbeischaffen und dann abschlachten ließen. Auch exotische Früchte kamen durch die Römer nach Europa, z. B. der Pfirsich. Ursprünglich aus China stammend, wo seine Kultur schon 2000 vor Chr. bekannt war, gelangte er über Persien nach Griechenland und in weiterer Folge durch die Römer nach Mitteleuropa. Der Name malum persicum (Pfirsich) bezog sich auf diese Herkunft. Die Kirsche wurde durch den römischen Feldherrn Lucullus aus dem kleinasiatischen Kerasos am Schwarzen Meer nach Europa gebracht und hier heimisch gemacht, von ihrem Herkunftsort leitet sich ihr Name in fast allen europäischen Sprachen ab.

Unter den Römern kamen nicht nur exotische Pflanzen, Tiere sowie Menschen als Sklaven in die Hauptstadt, man versuchte auch, das Erscheinungsbild der exotischen Länder nach Rom zu verpflanzen. Die römischen Villen und Thermen wurden mit riesigen Mosaikbildern von Nillandschaften und exotischem Ambiente mit entsprechender Fauna und Flora geschmückt, zahllose Obelisken aus Ägypten zierten die Metropole, mit Sphingen geschmückte Isistempel wurden errichtet und der römische General Cestius ließ seinen Sohn in einer Pyramide an der Porta Ostiense bestatten. Diese Lust auf Exotik kulminierte in der Villa Hadriana in Tivoli, wo sich der Kaiser eine komplette ägyptische Landschaft – inspiriert durch das Canopus-Tal bei Alexandria – nachbauen ließ.

Auch nach dem Untergang des römischen Imperium ließen sich die Menschen von exotischen Ländern faszinieren, wovon die Berichte über Marco Polos Reise bis nach China und zahllose Kreuzzugsberichte zeugen. Der Handel mit exotischen Gütern florierte wie eh und je und die Herrscher, die es sich leisten konnten, unterhielten eine Menagerie mit exotischen Tieren. Trotz der erschwerten Transportbedingungen wurden weiterhin exotische Früchte nach Europa exportiert.

Die deutsch-römischen Kaiser Karl der Große und Otto der Große ließen antike Spolien über die Alpen nach Deutschland transportieren und stellten sie in ihren Residenzen in Aachen und Magdeburg zur Bekräftigung ihrer Legitimation als römische Kaiser auf. Karls Palastkapelle in Aachen (das heutige Aachener Münster) griff auf die Vorbilder Hagioi Sergios kai Bakchos in Konstantinopel und San Vitale in Ravenna zurück. Durch die Kreuzzüge verbreiteten sich orientalische Motive an romanischen Kirchen – z. B. St. Viktor in Guntersblum – , und das Görlitzer „Heilige Grab“ – eine Kopie der entsprechenden Kapelle in der Grabeskirche von Jerusalem.

Die Kleeblattform der Geburtskirche in Jerusalem wurde in unzähligen Kirchenbauten Europas zitiert (am eindrucksvollsten in St. Maria im Kapitol in Köln), genau so wie die Rotunde der Kirche zum Heiligen Grab. Auch der europäische Burgenbau im Mittelalter griff viele im Morgenland entwickelte Bauformen wie Gusserker, Schießscharten und Zinnen auf. Aber bis zum gezielten Nachbau exotischer Architekturen nur zum Zwecke der Erbauung an der Exotik bedurfte es der Entwicklung der Herrschaftsform des Absolutismus, wo der Herrscherwille alles, auch eigentlich Überflüssiges, bewirken konnte.
Exotik wurde jetzt mit fernöstlich gleich gesetzt und es entwickelte sich eine Vorliebe für die Chinoiserie. In fast allen Schlössern gab es chinesische Zimmer, die mit pseudo-chinesischen Dekorationen (weil man eben noch sehr wenig über echte chinesische Kunst wusste), Möbeln und Porzellan ausgestattet wurden. In den Parks entstanden Teepavillons und Pagoden. Beliebte Dekorationsmotive waren abenteuerliche Landschaften mit hohen Bergen, Gewässern, Häusern und Menschen im asiatischen Stil. Ein weiteres sehr beliebtes Motiv war der Drache, in dessen geheimnisvoller Gestalt alle Sehnsüchte nach dem exotischen Land zu verschmelzen schienen. Diese Motive wurden anfangs von den importierten Waren übernommen aber aber später von den Künstlern nach eigenen Vorstellungen gestaltet.

In ganz Deutschland entstanden Chinoiserien in den Barock- und Rokokoschlössern, am eindrucksvollsten wohl in Potsdam mit den chinesischen Zimmern in Sanssouci und im Neuen Palais, sowie dem chinesischen Teehaus und dem Drachenhaus. Mit dem Aufkommen des Klassizismus wendete sich die Sehnsucht nach Exotik wieder dem Altertum zu und außer der feudalen Parkarchitektur mit Monopteros-Tempelchen und der sonstigen Palette von antiken Zierbauten entstanden jetzt auch dem Bürgertum dienende Bauten in antikem Stil wie Theater, Opernhäuser, Museen und Parlamentsbauten. Die Renaissance antiker Baukunst verwandelte ganze Städte in ein Neu-Athen: Spree-Athen, Isar-Athen und das Athen des Nordens (Edinburgh).

Durch den „Stilzirkus“ der Neo-Stile fanden dann sämtliche als exotisch empfundene Stilformen Eingang in die europäische Architektur: man baute maurisch, byzantinisch, russisch, indisch, japanisch, ja auch englisch, norwegisch und natürlich zu jeder Zeit italienisch. Die Umwälzungen nach dem Ersten Weltkrieg bildeten eine Zäsur und beendeten den Eklektizismus. Neue, an Sachlichkeit orientierte Bauformen entstanden und konkurrierten mit dem auftrumpfenden Baustil autoritär regierter Länder. Auch diese Welt verschwand, diesmal nach dem Zweiten Weltkrieg und es setzte sich ein an Zweckmäßigkeit und Gewinnoptimierung orientierter internationaler Baustil durch, der den Städten ein gleichförmiges Erscheinungsbild verlieh und die Sehnsucht nach dem Exotischen im Stadtbild erneut aufkeimen ließ.
Dieser Sehnsucht geht dieses Büchlein nach, indem es eine Weltreise zu exotischen Orten anbietet, ohne dass man dafür Berlin und Potsdam überhaupt verlassen müsste. Die Reise führt zu den kostbaren exotischen Orten, die in Berlin und Potsdam Krieg und Abriss überstanden haben. Mögen sich diese Stätten im Museum befinden, Bestandteil von Schlössern und Gärten sein, dem religiösen Kult gewidmet oder ganz profan, immer wird sich der Besucher an einem ganz ungewöhnlichen Ort befinden, der ihm suggeriert, nicht Hause zu sein, sondern in fernen, fremdländischen Gebieten, die die alten Griechen als „exotikì“ bezeichnet hätten.
02 Ägyptische Expeditionen
Richard Lepsius (1810 – 1884), außerordentlicher Professor an der Berliner Universität, brachte durch die von Friedrich Wilhelm IV. geförderte Expedition nach Ägypten (1842–1846) erstmals genauere Kenntnisse über dieses damals noch schwer zu bereisende Land nach Berlin. Er hatte sich mit sorgfältig ausgesuchten Mitarbeitern umgeben, den Gebrüdern Weidenbach als Zeichner, dem englischen Ägyptologen Joseph Bonomi, dem Architekten Erbkam und den Malern Georgi und Frey, durch die wissenschaftliche Aufzeichnungen, Kopien von Inschriften, Papierabdrücke, Planzeichnungen und Landschaftsbilder nach Berlin gelangten. Lepsius wurde durch diese Expedition und eine weitere im Jahre 1866 zum Begründer der Ägyptologie in Deutschland. Das reichhaltige, durch Lepsius mitgebrachte Material verbreitete sich schnell und sorgte für die Schaffung mehrer ägyptisierender Orte in Berlin.
Als herausragendes Beispiel muss dabei die Ägyptische Abteilung des zwischen 1843 und 1855 errichteten Neuen Museums von August Stüler gelten. Sie gruppierte sich in mehreren Sälen um einen Ägyptischen Hof und wurde nach Lepsius‘ Unterlagen überreich mit Malereien und architektonischen Einbauten versehen, die ein „ägyptisches Ambiente“ für die vielen von Lepsius mitgebrachten Fundstücke abgeben sollten. Die ausgeführten Malereien und Dekorationen dokumentierten den damals aktuellen Stand der Wissenschaft und hoben sich von der im französischen Empirestil verwendeten romantischen Ägyptenmode ab. Dennoch kam bald Kritik an dieser Präsentation auf, da die ägyptisierende Dekoration in zu große Konkurrenz zu den ausgestellten Originalkunstwerken trat. Außerdem stellte sie sich jeder Umgruppierung oder Neueinrichtung als Hindernis entgegen. Als nach den Ausgrabungen von Amarna (die auch die Nofretete zutage brachten) die Ausstellung vergrößert und neu gestaltet wurde, übertünchte man viele der Gemälde oder ließ sie unter abgehängten Decken verschwinden.

Im Krieg wurde das Neue Museum schwer beschädigt und blieb bis 1986 notdürftig gesichert als Ruine stehen. Dann sollte es – noch unter DDR-Regie – originalgetreu restauriert werden, was aber durch die Ereignisse von 1989 zum Erliegen kam. Nach der Wende setzte man den Wiederaufbau unter veränderten Grundsätzen fort: Der englische Architekt David Chipperfield propagierte einen Wiederaufbau in den alten Größenverhältnissen unter Verzicht auf Rekonstruktion der verlorenen Dekoration. Dies führte zu einer paradoxen Situation: Obwohl vieles der exorbitanten pseudo-ägyptischen Kulisse nun unwiederbringlich verloren war, kam auch bisher Verschwundenes wieder zum Vorschein, nämlich die unter den – jetzt wieder abgebauten – abgehängten Decken versteckten Originalmalereien der Erstausstattung.

So finden wir jetzt, nach der Neueinrichtung der ägyptischen Abteilung im Neuen Museum, einen wunderbaren exotischen Ort vor. Die erhaltene Dekoration versetzt einen gleichsam an den Originalschauplatz und die hervorragenden originalen Ausstellungsstücke scheinen dadurch wieder im gewohnten Zusammenhang zu stehen. Auch das Untergeschoss, in dem in beeindruckenden Gewölben die Exponate zum ägyptischen Totenkult stehen, verbreitet die Illusion, sich in einer Pyramide oder einem ägyptischen Totentempel zu befinden. Lediglich Nofretete, die Ikone der gesamten Ausstellung, muss sich – zwar hervorragend präsentiert – mit einem römischen Kuppelsaal, der mit pompejanischen Wandmalereien verziert ist, zufrieden geben.
Am ehemaligen Standort des West-Berliner Ägyptischen Museums befindet sich ein weiterer „ägyptischer Ort“, nämlich in der heutigen Sammlung Scharf-Gerstenberg in Charlottenburg. Zwei dort eingebaute – in der Sammlung surrealistischer Grafik und Malerei reichlich deplaziert wirkende – ägyptische Großarchitekturen werden an diesem Ort verbleiben, bis das Pergamonmuseum umgebaut und saniert ist, also bis ca. 2023! Doch auch „am falschen Platz“ wirkt das Kalabscha-Tor in der Eingangssituation des ehemaligen Marstalls sehr stimmig und kreiert einen weiteren dieser bezaubernden Orte, die dieses Büchlein Ihnen nahe bringen will. Die Kalksteinblöcke des Tores kamen bei den Rettungsarbeiten für den vom Bau des Assuanstaudamms und anschließender Überflutung bedrohten Tempel von Kalabscha zutage. Beim Abbau des Tempels fanden sie sich als Füllmaterial im Fundament des Gebäudes. Die Rekonstruktion ergab ein Eingangstor zum Tempelbezirk zwar aus römischer Zeit, aber in eindeutig ägyptischem Baustil. Als Dank für die von der Bundesrepublik geleistete Hilfe bei der Rettung und dem Neuaufbau des Tempels auf der Insel Elephantine – der Originalplatz ist längst in den Fluten des Nasser-Stausees versunken – übergab die ägyptische Regierung der deutschen die geborgenen Kalksteinblöcke, welche daraufhin dem Ägyptischen Museum in West-Berlin überlassen wurden.

Im selben Museum befinden sich auch die Säulen und Architrave des Sahure-Tempels, eines Gebäudes, das stellvertretend für das Schicksal vieler Berliner Kunstschätze während des 2. Weltkriegs steht. In den Jahren 1902 bis 1908 erforschte der spätere Entdecker der Nofretete, der Archäologe Ludwig Borchardt den Komplex der Sahure-Pyramide und führte dabei Ausgrabungen durch, bei denen der Totentempel gefunden wurde. Im Rahmen der Grabungen wurden im Pyramidentempel die noch weitgehend erhaltenen Säulen und Architrave des Tempelhofs geborgen und zwischen Deutschland und Ägypten aufgeteilt. Der deutsche Teil kam nach Berlin auf die Museumsinsel, konnte aber wegen Platzmangels nicht ausgestellt werden und verblieb im Depot. Beim Brand des Neuen Museums erlitten die hitzedurchglühten Steine durch Löschmaßnahmen schwere Beschädigungen. Erst in den 1980er Jahren wurden sie im West-Berliner Ägyptischen Museum zum Teil wieder aufgestellt. Wie das Kalabscha-Tor sollen sie erst nach der Sanierung des Pergamonmuseums auf die Museumsinsel umziehen.

Zwei weitere „ägyptische Orte“ kann man auf Berliner Friedhöfen finden. Der eine, das Grab des Ägyptologen Heinrich Brugsch, erinnert an ein Leben zwischen Orient und Okzident. Brugsch (1827 – 1894), der vom ägyptischen Vizekönig den Titel Pascha verliehen bekam und viele Jahre in Ägypten verbrachte, gilt als letzter der großen Ägyptologen des 19. Jh. Die Tragik seines Lebens war, dass er trotz seiner Reputation nie eine seinem Können angemessene Stellung angeboten bekam und so sein ganzes Leben zwischen Berlin, Ägypten, Göttingen und vielen anderen europäischen Städten pendelnd verbrachte. Er wurde auf dem Luisenfriedhof III in Westend begraben. Sein Grabmal ist einzigartig, da es sich um einen Sarkophagdeckel handelt, der wahrscheinlich aus dem Alten Reich (2400–2200 v. Chr.) stammt. Die Sargplatte besteht aus Assuan-Granit und befand sich früher in Sakkara. Für das Grabmal wurde sie senkrecht aufgestellt und beschriftet. Nach 2000 hat sie der Förderverein des Ägyptischen Museums restaurieren lassen.

Das zweite Grab, auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Kreuzberg, verdankt seinen Stil eher dem ägyptisierenden französischen Empire. Es wurde für die jüdische Familie Oppenheim gebaut, die sich nach dem Übertritt zum Protestantismus und anschließender Nobilitierung von Oppenfeld nannte. Das Mausoleum zitiert nur ägyptische Formen, ohne ein bestimmtes Gebäude zu kopieren. Auch die Ausführung in Putz und die Farbgebung entsprechen nicht dem ägyptischen Brauch. Man kann annehmen, das die Familie durch die Wahl des exotischen Baustils für das Grabmal ihre durch den Adelstitel neu gewonnene soziale Stellung unterstreichen wollte.
03 Pilgern nach Babylon: Prozessionsstraße und Ischtar-Tor
Das Pergamon-Museum mit seinen riesigen Sälen, in denen ganze Architekturkomplexe wieder aufgebaut sind, ist der beste Ort in Berlin, um sich längst untergegangene Orte mit ihren Monumenten in einem stimmigen Umfeld anschaulich zu machen. Hier kann man gleichzeitig in eine mehrere tausend Jahre alte Vergangenheit als auch an exotische Orte reisen, die bis zum heutigen Tag für den Besucher schwer erreichbar sind. Ein solcher Ort ist das antike Babylon, heute im Krisengebiet des Irak gelegen, aus dem die Archäologen erstaunliche Dinge nach Berlin gebracht haben.
Während die Engländer bereits seit 1840 Mesopotamien, die Wiege der Menschheit, durch Forschungsreisen und Grabungen erkundeten, trat Deutschland erst 1898, mit Gründung der Deutschen Orient-Gesellschaft in dieses Forschungsfeld ein. Robert Koldewey (1855 – 1925) hatte bereits 1897 eine sondierende Vorexpedition ins Zweistromland unternommen, um geeignete Orte für die Tätigkeit der Deutschen Orient-Gesellschaft ausfindig zu machen. Er brachte dabei Bruchstücke von glasierten Reliefziegeln aus Babylon mit, die er in Berlin zusammensetzte und der Kommission der Museen zu Berlin vorlegte. Diese war davon so beeindruckt, dass sie Babylon als Ausgrabungsort auswählte und Koldewey mit der Leitung des Projekts betraute.
Bei den Grabungen, die den Verlauf der berühmten Stadtmauer und die Lage des sagenhaften „Turms zu Babel“ erkunden sollten, stellte Koldewey zunächst fest, dass die babylonischen Bauten zum größten Teil aus luftgetrockneten Lehmziegeln errichtet waren, die im Laufe der Jahrtausende zu Staub zerfallen waren. Lediglich in tieferen Schichten, konserviert durch den Schutt der Jahrtausende oder in Bereichen, wo Brände gewütet und die Lehmziegel buchstäblich gebrannt hatten, wurde Koldewey noch fündig. Am meisten erstaunte ihn die Menge von Schutt aus gebrannten und glasierten Reliefziegeln, wie er sie bereits bei der Vorexpedition gefunden hatte. Koldewey schloss nun aus der Menge des Schutts und der Qualität der Gestaltung, dass es sich hierbei um Überreste einstmals bedeutender Bauten handeln müsste.

Aus der großen Anzahl in gleichartiger Weise schreitender Löwen, die sich aus der Zusammensetzung vieler Reliefziegel ergaben, konnte man auf eine Dekoration der berühmten Prozessionsstraße schließen, die laut antiker Quellen auf das Ischtar-Tor führte. Sich in derselben Weise anordnende Tiere (abwechselnd Stiere und Fabelwesen) deuteten auf die Dekoration dieses Tores. Vom Schutt beider Ausgrabungsorte ließ Koldewey von 1899 bis 1914 eine riesige Menge von glasierten Ziegelbruchstücken in 800 Transportkisten nach Berlin schaffen. Wegen ihres starken Gehalts an Schadsalzen mussten die Fragmente im Wasserbad entsalzt und anschliessend konsolidiert werden. Erst danach konnte man mit der Zusammensetzung beginnen, ein Prozess der bis 1929 andauerte und schließlich 1929/30 die Rekonstruktion durch Walter Andrae ermöglichte.
Abgesehen von der exakten Gebäudehöhe war es relativ leicht möglich, das Aussehen der Gebäude zu rekonstruieren, da die Grundrisse an Ort und Stelle ergraben wurden und das aufgehende Mauerwerk mit sich permanent wiederholenden Ornamenten gerahmt war. So fasste man den Entschluss, sowohl die Prozessionsstraße als auch das Ischtar-Tor im Museum wieder aufzubauen. Man stellte dafür eine große Menge glasierter blauer Ziegel neu her, um auch die undekorierten Teile der Mauern zu rekonstruieren. Oberstes Gebot war, dass die Existenz der nachgefertigten Teile aus der Fundlage oder dem Gesamtzusammenhang mit großer Sicherheit abgeleitet werden konnte.

Das fertige Ergebnis war überaus erstaunlich und trug zum Weltruhm des Pergamon-Museums bei: 30 m lang und 8 m breit ist die Rekonstruktion der Prozessionsstraße (allerdings gegenüber 180 x 20 m im Original!), 28 m breit und fast 16 m hoch das Ischtar-Tor, beide komplett im Innern eines Gebäudes aufgebaut und aufeinander ausgerichtet. Zusammen mit den in den angrenzenden Flügeln ausgestellten Fundstücken und den großflächigen Wandgemälden, die das Gelände von Babylon während der Ausgrabung zeigen, kann sich der Besucher wunderbar an diesen exotischen Ort versetzen und einen tiefen Eindruck in das Leben der Babylonier und ihre Architektur vor 2600 Jahren gewinnen. (Durch die dringend notwendige Renovierung des Pergamonmuseums ist dieser wunderbare exotische Ort leider noch für Jahre den Blicken der Öffentlichkeit entzogen, was auch für die folgenden Orte in Kleinasien gilt, deren Monumente im Pergamonmuseum aufgebaut sind.)
04 Ins hellenistische Kleinasien: Pergamon und Milet
Carl Humann (1839 – 1896), ein deutscher Ingenieur, Architekt und Archäologe lebte und arbeitete seit 1861 in der Türkei. Als Spezialist für Straßenbau bereiste er die Gegenden, wo derartige Planungen anstanden. So kam er im Winter 1864/65 in die kleinasiatische Stadt Bergama, wo ihm auf dem Burgberg Kalkbrenner auffielen, die antike Bildwerke aus Marmor mit Vorschlaghämmern zerkleinerten und die Bruchstücke in Öfen zu Kalk brannten. Zunächst versuchte er vor Ort, dem damals noch nicht ausgegrabenen Pergamon, diesen Vandalismus aufzuhalten, doch erschien es ihm bald günstiger, über eine Ausgrabungsgenehmigung die Stätte zu erforschen und die Kunstwerke zu retten. Er hatte nämlich festgestellt, dass die Kalkbrenner ihr Material aus der Befestigungsmauer des Burgbergs holten, in der große Marmorblöcke verbaut waren, die auf der Seite, die im Innern der Mauer lag, mit Skulpturen versehen waren.
Es dauerte einige Jahre bis es Humann gelang, in Berlin Interesse für das Grabungsprojekt zu wecken. Auf höchster Ebene wurde endlich ein offizieller Grabungsvertrag geschlossen, der alle Funde der deutschen Seite zusprach. Für diese Großzügigkeit der Türken gab es zwei Gründe: einerseits die traditionell guten Beziehungen zwischen Deutschland und dem osmanischen Reich und andererseits die Tatsache, dass die muslimische Türkei die griechische Antike noch nicht als Teil ihres Kulturerbes begriffen hatte. Die ersten Fundstücke, die Humann nach Berlin schickte, erregten ob ihrer Größe und künstlerischen Qualität großes Aufsehen, so dass sich bald die Frage aufwarf, zu welchem Gebäude Pergamons sie einmal gehört hatten. Die Identifikation der Darstellungen auf den Reliefs als Kampf der Götter gegen die Giganten (Gigantomachie) führte zum Zeusaltar von Pergamon, einem in antiken Quellen sowie auf einer der vielen Listen der Sieben Weltwunder aufgeführten Monument, auf dem sich eine solche Darstellung befunden hatte. Es war im Laufe der Jahrhunderte völlig verschwunden aber jetzt stellte sich heraus, dass seine Steine in der Befestigungsmauer des Burgberges von Pergamon verbaut waren.
Von 1878 bis 1886 dauerten die Ausgrabungen und in Berlin musste man sich bereits überlegen, wo die umfangreichen Funde ausgestellt werden sollten, denn das dafür zuständige Alte Museum konnte sie nicht fassen. 1897 – 1899 wurde deshalb von Fritz Wolff ein eigenes Museum für die Pergamon-Funde erbaut, ein Gebäude, das sich bereits bei der Eröffnung als zu klein erwies. Man hatte darin einen Teil der Fassade des Altars rekonstruiert, die Friesplatten aber noch separat aufgestellt. Da bei weiteren Grabungen in Kleinasien eine Menge weiterer Funde nach Berlin kam und außerdem die Deutsche Orient-Gesellschaft in Mesopotamien sensationelle Funde machte, ging man an die Planung eines neuen Pergamon-Museums, das alle Kunstwerke aufnehmen sollte und in dem man den Pergamon-Altar möglichst vollständig rekonstruieren wollte. Erleichtert wurde die Planung durch die Tatsache, dass der Vorgängerbau durch den schlechten Baugrund bereits nach zehn Jahren baufällig war.
Seit 1907 lief die Planung für den Neubau unter der Leitung des renommierten Architekten Alfred Messel. Nach dessen Tod 1909 übernahm Stadtbaurat Ludwig Hoffmann diese Aufgabe und versuchte sie im Sinne Messels weiterzuführen. Verschiedene Faktoren zogen den Bau in die Länge, zum einen die Fundamentarbeiten in dem bekannten schlechten Untergrund sowie der Erste Weltkrieg und die darauf folgende Inflation, zum anderen die pausenlosen Umplanungen aufgrund des Zustroms weiterer sensationeller Fundstücke nach Berlin, wie dem Markttor von Milet und der Mschatta-Fassade. So dauerte es bis 1930, bis man das neue Pergamon-Museum mit seinen vier Abteilungen eröffnen konnte. Das Gebäude war aber keineswegs fertig, am Kupfergraben fehlte noch die Kolonnade, die den Nordflügel mit dem Südflügel verbinden sollte. (Sie ist bis heute nicht ausführt worden und wird ab 2025 bei der Sanierung und Erweiterung des Pergamon-Museums durch einen vierten Flügel, entworfen von Oswald Mathias Ungers, ersetzt).

Prunkstück des neu eröffneten Museums war der Pergamon-Altar, dessen komplette Fassade sich an einer Seite des riesigen Saals erhebt und dessen Fries zusammenhängend an den übrigen drei Seiten angebracht ist. Die gewaltige Treppenanlage des Altars ist begehbar und führt durch die Kolonnade in einen oberen Saal, in dem der Telephos-Fries ausgestellt ist, der eine Darstellung der Gründungssage Pergamons zeigt. Das Thema der Gigantomachie, des Kampfes der Götter gegen die Giganten stand in der Antike für den Kampf des Guten gegen das Böse, für Ordnung gegenüber dem Chaos und für Recht gegenüber dem Unrecht. Die Pergamener hatten es sich als Thema für den großen Fries gewählt, weil sie ihren eigenen Kampf gegen die Galater mit dieser Götterschlacht gleichsetzten.
Im nächsten Saal findet sich eine weitere Inszenierung antiker Großarchitektur, die Rekonstruktion des Markttors von Milet. Dieser Eingang zur Agora von Milet war bei einem mittelalterlichen Erdbeben auf den sandigen Boden des Platzes gestürzt und dabei nur wenig beschädigt worden. Da die Siedlungsstätte von Milet durch Versumpfung und Malaria bald unbewohnbar geworden war, verblieben alle Steine am originalen Ort, wo sie unter Flugsand begraben und dadurch noch weiter geschützt wurden. 1903 wurden sie von Hubert Knackfuß und Theodor Wiegand entdeckt und mit Genehmigung der türkischen Behörden nach Berlin gebracht. Aufgrund der Vollständigkeit des Fundes entschloss man sich, das Gebäude im Pergamonmuseum wieder aufzubauen, wo es seit 1930 der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Schon 9 Jahre später wurde das Museum wegen des Krieges wieder geschlossen, das riesige Tor konnte nicht abgebaut werden und wurde nur notdürftig mit Sandsäcken gegen eventuelle Bombentreffer geschützt. Eine auf das Gebäude fallende Bombe beschädigte es schwer und erst 1958 konnte das Museum und das restaurierte Tor wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Einen besonderen Zauber erhält der exotische Ort durch zwei Inschriften am Tor, die ein wenig vom Leben der Antike ins hier und jetzt holen. Zwischen den Säulen neben dem rechten Seitenportal befindet sich eine – rot ausgemalte – krakelige Dankinschrift eines Friseurs, der an dieser wegen des Publikumsverkehrs hoch profitablen Stelle seinen Friseurstuhl aufstellen durfte und auf der linken Seite des Hauptdurchganges das Graffitto eines Herrn Attalos aus Ephesos, der auf diesem Weg die Herren Milesier grüßt. („Kilroy was here“ – vor 1900 Jahren!)
05 Baden wie bei den alten Römern
Zu den beeindruckendsten Bauleistungen der Römer gehören ihre Thermenalagen. Weiterentwickelt aus Badeeinrichtungen der orientalisch/griechischen Antike stellten sie ein bis in die Neuzeit unübertroffenes Freizeitensemble dar, das so vielfältige Funktionen wie Sportplatz, Sauna, Schwimmhalle, Bibliothek, Ruheräume und vieles andere mehr umfasste. Die Thermen gehörten zur römischen civitas und verbreiteten sich mit ihr um den gesamten Mittelmeerraum herum und über große Teile Europas. Mit dem Untergang des imperium romanum, der Sklavenhaltergesellschaft und der hoch entwickelten römischen Baukultur, die diesen Luxus erst ermöglichten, verschwand die antike Badekultur für mehr als tausend Jahre. Die Prüderie des Christentums und das Wissen um im freizügigen Badewesen leicht übertragbare Geschlechtskrankheiten bestärkten diese Entwicklung noch.
Erst im Industriezeitalter, als der wirtschaftliche Fortschritt eine Bevölkerungsexplosion bewirkte und die Gesellschaft durch Epidemien großen Ausmaßes erschüttert wurde, besann man sich wieder auf Badekultur vergangener Zeiten. Auch moderne Erkenntnisse über Volksgesundheit, die neben der Hygiene auch den Aspekt der Körperkultur berücksichtigten, führten zur Entwicklung der Volks-Badeanstalten des 19. Jh. Sie sollten den Arbeitern, deren Wohnungen keinerlei hygienische Standards aufwiesen, ermöglichen, in diesen Einrichtungen ein Wannenbad zu nehmen, bzw. in großen Freianlagen – oft an Flüssen oder Seen gelegen – den Körper zu ertüchtigen, um ihre Arbeitskraft zum Nutzen der aufstrebenden Wirtschaft zu reproduzieren. Da diese Volks-Badeanstalten oft nur saisonal zu benutzen waren, planten jetzt viele reich gewordene Gemeinden große Hallenbäder, die die Idee der römischen Thermenanlage wieder aufnahmen und die Aktivitäten der Volksbadeanstalten ganzjährig unter einem Dach zusammenfassten.
Die Stadt Rixdorf, ab 1912 Neukölln, war schon vor der Gründung Groß-Berlins 1920 die größte Arbeiterstadt im Ballungsraum Berlin. 1914 beschloss die Stadt die Errichtung eines Stadtbades auf dem Gelände einer früheren Volks-Badeanstalt durch den Stadtbaurat Reinhold Kiehl, der auch für den Bau des Neuköllner Rathauses, des Krankenhauses Neukölln und der Galerie im Körnerpark verantwortlich war. Zusammen mit Heinrich Best entwarf Kiehl ein neoklassizistisches multifunktionales Gebäude, das der Pflege der Körperhygiene, der körperlichen Ertüchtigung und der geistigen Erbauung dienen sollte. Deshalb brachte er im Gebäude eine medizinische Abteilung sowie Brause- und Wannenbäder, zwei Schwimmhallen in römisch-antikem Stil, griechisch-römische Bäder und die Volksbibliothek unter.

Der Grundriss der Schwimmhallen lehnt sich an die Bauform griechischer Tempel und römischer Basiliken an und ist mit Säulen aus Travertin, Wandverkleidungen aus Marmor, Wandelgängen, Bildhauerarbeiten und Mosaiken der Firma Puhl und Wagner aus Neukölln ausgestattet, die als erste in Europa die antike Mosaiktechnik wieder auf ein vergleichbares Niveau brachte. Nach dem Beispiel der römischen Thermen wurde eine russisch-römische Badeanlage eingerichtet, zu der u.a. ein Kuppelbau mit Oberlicht und rundem Tauchbecken gehörte. Zur Zeit seiner Errichtung war das Bad eines der größten und modernsten Bäder Europas und für bis zu 10.000 Besucher täglich ausgelegt. Männer und Frauen badeten getrennt voneinander in der großen und kleinen Schwimmhalle.

Das Stadtbad überstand die Weltkriege relativ unbeschadet, von 1961 bis 2010 wurde das Museum Neukölln in den Räumen der Volksbibliothek untergebracht. 1978 schloss das Bad für eine mehrjährige Renovierung während der für 25 Millionen Mark die große und kleine Schwimmhalle originalgetreu wiederhergestellt und die anderen Bereiche modernisiert wurden. 1984 wurde es wiedereröffnet und gleichzeitig unter Denkmalschutz gestellt. Ende der 1990er Jahre restaurierte man auch die Therme in den historischen Räumlichkeiten und eröffnete sie 1998. Das Schwimmbad wird heute von den kommunalen Berliner Bäder Betrieben verwaltet, während der Saunabereich privat betrieben wird. Dieser umfasst eine finnische Sauna, eine Kräutersauna, ein Marmordampfbad, ein Caldarium und ein Sanarium. Mit dem nötigen „Kleingeld“ ausgestattet, können wir uns heute also wieder ein exotisches Badeerlebnis wie bei den alten Römern gönnen.
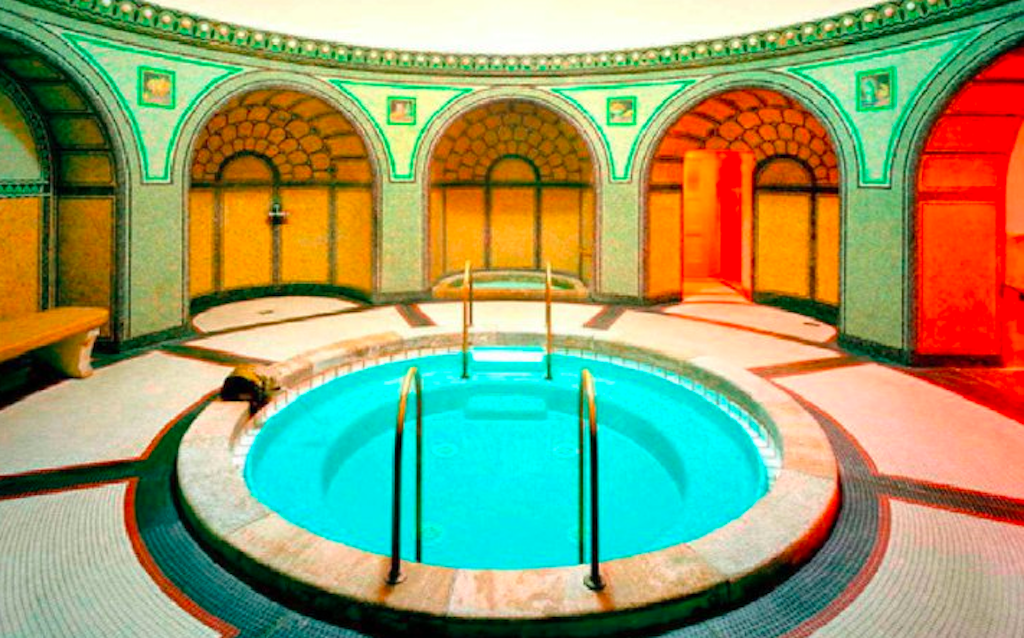
06 Goldenes Byzanz – S. Michele in Africisco, Ravenna
Besucht man das Bode-Museum auf der Museumsinsel und begibt sich in die frühchristlich-Byzantinische Abteilung, so wird man an deren Ende auf eine wunderbare Inszenierung der byzantinischen Baukunst stoßen: In einem hallenartigen Raum ist an der Stirnwand ein in leuchtenden Farben auf goldenem Grund prangendes Mosaikbild angebracht. Es zeigt in der Apsisnische Christus victor mit den Erzengeln Gabriel und Michael. Auf der Stirnwand darüber befindet sich ein thronender Christus mit zwei Erzengeln und sieben Posaunenengeln, in den Zwickeln rechts und links darunter sieht man schemenartige Umrisse mit den darüber geschriebenen Namen Cosmas und Damian. Die zwei Heiligen sind in der leidvollen Geschichte, die das Kunstwerk in den letzten 200 Jahren durchgemacht hat, verloren gegangen.
Das Mosaik war 545 in der Kirche San Michele in Africisco in Ravenna angebracht worden, kurz nachdem das byzantinische (oströmische) Reich diese letzte Hauptstadt Westroms von den Goten erobert hatte. Auf diese historischen Fakten weist die Inschrift in dem geöffneten Buch hin, das Christus in der Hand hält: „Wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Ich und der Vater sind eins“. Diese Worte waren gegen all jene gerichtet, die die Wesensgleichheit von Gottvater und Jesus Christus bestritten und zu denen vor allem die arianischen Ostgoten gehört hatten, welche in Ravenna bis zur byzantinischen Eroberung im Jahre 540 n. Chr. herrschten.

Die relativ kleine Kirche erhielt inmitten der vielen monumentalen byzantinischen Kirchen Ravennas nur eine geringe Wertschätzung. Seit den napoleonischen Kriegen in Oberitalien war sie dem Kultus entzogen und 1812 sollte sie zu einem Laden umgebaut werden. 1840 war das Mosaik durch die entfremdete Nutzung bereits so stark beschädigt, dass man eine schützende Mauer vor der Apsis hochzog. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Aquarellkopie von Enrico Pazzi angefertigt, denn der Besitzer des Gebäudes plante den Verkauf des Mosaiks. Alexander von Minutoli (1806 – 1887), Kunstmäzen und Sohn des Prinzenerziehers Heinrich Menu von Minutoli, der Friedrich Wilhelm IV. erzogen und ihm die mittelalterliche und byzantinische Kunst nahegebracht hatte, entdeckte das Mosaik und die Möglichkeit, es zu erwerben und unterrichtete den preußischen König davon.
Friedrich Wilhelm, der Ravenna kannte und auch bereits ein spätbyzantinisches Mosaik für die Friedenskirche in Potsdam (s.o.) erworben hatte, war an einem Ankauf sehr interessiert. 1843 wurde ein Vertrag ausgehandelt, dem der Papst zustimmte, gegen den die Stadt Ravenna sich jedoch sträubte. Inzwischen erstellte der venezianische Experte Pajaro eine Pause des Mosaiks und markierte die Fehlstellen; zusammen mit dem bereits existierenden Aquarell ging beides nach Berlin und bewirkte den Ankauf gegen den erklärten Willen der Stadt Ravenna.
1844 nahm der Mosaizist Liborio Salandri aus Venedig das Mosaik ab und brachte es nach Venedig. Er begann sofort mit der Restaurierung aber starb darüber bereits 1846. Bei den Freiheitskämpfen der Italiener gegen die Österreicher 1849 wurde das Atelier des Verstorbenen durch Artillerietreffer beschädigt, die Decke stürzte ein und beschädigte auch einen Teil des Mosaiks. In der Zwischenzeit hatte Preußen Druck gemacht um das Mosaik endlich geliefert zu bekommen, währenddessen wurde das Mosaik von dem neuen Restaurator Giovanni Moro bearbeitet, der neue Glassteinchen herstellte, Fehlstellen ergänzte und wohl auch einige Teile vorab verkaufte. Er stellte auch eine Montagezeichnung her um die Anbringung zu erleichtern.
1851 kam das Mosaik nach Berlin und verblieb 25 Jahre verschlossen in den Transportkisten, denn Friedrich Wilhelm, der Betreiber des Ankaufs, war durch mehrere Schlaganfälle mittlerweile regierungsunfähig geworden. Erst 1876 wurde es für eine Reinigung ausgepackt und anschließend für weitere 25 Jahre weggeschlossen. Für die geplante Aufstellung im Museum ließ man es 1900 von der bekannten Firma Puhl und Wagner nochmals restaurieren. Diese entwickelte das Verfahren, „Originalsteinchen“ durch die Spaltung der vorhandenen zu gewinnen.

1903 kaufte Wilhelm von Bode das Mosaik aus San Michele in Africisco für die altchristliche Sammlung des Kaiser-Friedrich-Museums (heutiges Bodemuseum) und ließ es 1904 dort einbauen, wo es ein Highlight der dortigen Ausstellungen wurde. Im Krieg erlitt das Gebäude die auf der Museumsinsel vergleichsweise geringsten Schäden, doch erst 1951 erhielt es ein Notdach. In dieser Zeit wurde das Mosaik durch Witterungseinflüsse erneut schwer beschädigt. Wiederum mussten für die Restaurierung Mosaiksteinchen durch Teilung neu gewonnen werden.
Durch diese vielen unglücklichen Wiederherstellungsmaßnahmen ist der Originalcharakter des Mosaiks nahezu komplett verloren gegangen. Es ist gewissermaßen nur noch die Erinnerung an ein verlorenes Kunstwerk. Als exotischer Ort taugt die Präsentation aber allemal, weil durch die in die Entstehungszeit des Mosaikbildes gehörenden Exponate des Umfeldes ein stimmiger Eindruck erweckt wird, sich an einem Ort in Byzanz zu befinden.
07 Islamische Schlösser und ein Zimmer: Mschatta, Alhambra und Aleppo
Das Pergamonmuseum ist der beste Ort Berlins, um an einem kalten, verregneten Novembertag Expeditionen in exotische Länder unter angenehmen klimatischen Bedingungen zu unternehmen. Durch seine riesigen Säle, die von Anfang an zur Aufnahme von Großarchitektur konzipiert wurden, durch die Vollständigkeit der wieder aufgebauten Monumente und nicht zuletzt durch die überzeugende Präsentation kann man sich hier ganz der Illusion hingeben, auf den Spuren berühmter Wissenschaftler einmalige exotische Orte aufzusuchen. Durch die ständig zunehmende Beliebtheit Berlins als touristisches Reiseziel muss man sich dieses Erlebnis an den Wochenenden allerdings mit vielen Menschen teilen.
Das Wüstenschloss Mschatta

Auf nur wenigen Metern im Museum kann man zum Beispiel einen vor Ort 1000 Kilometer langen Streifzug durch die islamische Welt unternehmen. Er beginnt im Obergeschoss des Südflügels in der islamischen Abteilung. (Im Zuge des Masterplans Museumsinsel werden die beschriebenen Installationen alle ihren Ort im Museum wechseln, aber die mehrere Milliarden teure Umstrukturierung wird wohl noch die nächsten 10 Jahre in Anspruch nehmen). Am Ende der Säle des Islamischen Museums befindet sich der Mschatta-Saal. Es ist schon atemberaubend, wenn nach Passieren des Eingangs die 33 Meter lange und 5 Meter hohe Fassade des Wüstenschlosses Mschatta mit ihren zwei Tortürmen vor einem auftaucht. Es handelt sich dabei um die eindrucksvollen Reste der Eingangssituation eines 30 Km südlich der jordanischen Hauptstadt Amman gelegenen Palastes, der einst 144 Meter im Quadrat maß und von dem umayyadischen Kalifen Al-Walid (743-744) begonnen wurde. Durch die Ermordung des Herrschers wurde er nie vollendet und in späteren Jahrhunderten durch Erdbeben zerstört. Die hier präsentierten Überreste waren die am besten erhaltenen Teile des Gebäudes und zeichnen sich durch eine sensationelle Dekoration aus: Einem Teppichmuster gleich sind die Steine kunstvoll mit eingemeißelten Ornamenten überzogen, unter denen sich Pflanzen- und Tierdarstellungen befinden, die in der späteren islamischen Kunst durch das Bilderverbot nur noch äußerst selten vorkommen.

Das Schloss wurde erst um 1840 von europäischen Reisenden „entdeckt“ und bis 1880 regelmäßig aufgesucht. Als das osmanische Reich in den 1880er Jahren den Bau der Hedschasbahn von Damaskus nach Medina (und zu den heiligen Stätten des Islam) in Angriff nahm und deutsche Ingenieure mit der Planung beauftragte, kam die Befürchtung auf, dass durch die Baumaßnahmen das in der Nähe der Trasse liegende, einzigartige Baudenkmal des Wüstenschlosses zur Gewinnung von Baumaterial geplündert oder die skulptierten Steine mit eben dieser Bahn abtransportiert werden könnten. Der Straßburger Orientalist und Arabien-Forscher Johannes Euting wandte sich mit diesem Anliegen an Sultan Abdülhamid II., der daraufhin die Fassade zum Abbruch frei gab und 1903 die Steine zum Wiederaufbau in einem Museum an seinen Freund, Kaiser Wilhelm II., verschenkte. Der Abtransport erfolgte – wie befürchtet, jetzt aber gewollt – mit der Hedschasbahn. Wilhelm vergab die Fassade zunächst an das Kaiser-Friedrich-Museum (heute Bode-Museum), erst nach dem Bau des Pergamon-Museums kam sie 1932 an ihren heutigen Ort. Doch schon 1939 wurde das Museum wegen Hitlers Entfesselung des 2. Weltkrieges wieder geschlossen. Die Großarchitektur des Wüstenschlosses erwies sich als ungeeignet für die Verbringung in ein Depot und blieb – durch Sandsäcke notdürftig gesichert – an Ort und Stelle. Die auf das Pergamonmuseum fallenden Bomben beschädigten die im Museum verbliebenen Kunstdenkmale schwer, so stürzte auch der linke Torturm von Mschatta ein. 1954 wurde – nach der Restaurierung des Wüstenschlosses – das „Islamische Museum“ im Pergamonmuseum wiedereröffnet.

Jetzt wartet es auf die Verlagerung in den Nordflügel des Museums, wo es, nur durch die Außenmauer von der Bahnlinie getrennt, wieder einen ähnlichen Standort wie einst in Jordanien haben wird. Den stärksten Zauber als exotischer Ort entwickelt Mschatta, wenn bei der Langen Nacht der Museen in Galabija gekleidete Musiker auf al-ud (Laute) und at-tabl (Trommel) davor stehen und arabische Musik spielen.
Die Torre de las Damas in Granada
Gleich vor dem Mschatta-Saal befindet sich ein kleiner quadratischer Raum, der eine phantastische, geschnitzte Holzkuppel besitzt. Hier können wir uns ganz original in der Alhambra von Granada fühlen, dem Palast der nasridischen Emire von Granada. Unter den Umayyaden war 756 fast ganz Spanien von den Arabern überrannt worden, die – nach dem Untergang des umayyadischen Kalifats in Damaskus im Jahre 750 – hier auch wieder den Kalifentitel annahmen (929). Durch die reconquista (christliche Rückeroberung) wurden die Muslime im Laufe der Jahrhunderte beständig zurückgedrängt, einzig das kleine Emirat von Granada verblieb bei den Muslimen. Hier entwickelte sich Mitte des XIV. Jh. eine letzte Blüte des Islam in Europa, so wurden auf der Stadtburg, der Alhambra, mehrere Paläste errichtet, zu denen auch der Palacio del Partal (im 19. Jh. Torre de las Damas genannt) gehörte. Im Hauptturm dieses Komplexes befand sich die Kuppel, die jetzt im Pergamon-Museum eingebaut ist.

1891 wurde das hölzerne Kuppeldach des Aussichtsturms mit Erlaubnis der spanischen Behörden ausgebaut. Der damalige Besitzer, der Frankfurter Bankier Arthur von Gwinner (1856 – 1931) – führender Bankier der zweiten Generation der Deutschen Bank – hatte das Anwesen von späteren, entstellenden Einbauten befreien lassen und nutzte es als privaten Landsitz. 1891 schenkte er es dem spanischen Staat und durfte dafür die Kuppel mitnehmen. Sie wurde in sein Spanisches Zimmer in der Rauchstraße 1 im Bezirk Tiergarten von Berlin – wo er seit seiner Aufnahme ins Preußische Herrenhaus wohnte – eingebaut. Das Haus wurde im 2. Weltkrieg zerstört, die zuvor ausgebaute Kuppel überstand jedoch die Zerstörung. Das Islamische Museum in West-Berlin erwarb sie 1978 von den Enkeln des Besitzers und stellte sie – von der Decke hängend – in den Räumen in Dahlem aus. Als nach der Wende die Museen in Ost und West vereint wurden, kam sie ins Pergamon-Museum und wurde in den Raum, in dem sie sich jetzt befindet, so effektvoll eingefügt.

Die aus vielen Einzelteilen zusammengesetzte Kuppel hat im Zentrum ein Dach aus 16 Brettern mit Sternflechtwerk, die um ein Sternenornament angeordnet sind. Dieses Dach ruht auf einem sechzehneckigen Sockel mit einem muqarnas-Gesims (= Stalaktitengewölbe). Schmale Dreieckzwickel mit Muschelrosette bilden den Übergang zu einem Achteck, dessen Teile mit Vierpassbögen und Muscheln verziert sind. Dazu kommen arabische Inschriften. Vier Dreiecke mit kleinen muqarnas-Küppelchen erscheinen in den Ecken als Übergang zu dem quadratischen Turmraum, in dem die Kuppel einmal saß.
Die spanische Regierung erhebt heute keine Forderung auf Rückgabe der Kuppel. Sie betrachtet sie als exzellente Botschafterin Spaniens und findet sie in Berlin gut aufgehoben.
Das Aleppo-Zimmer
Am Ende der Säle des islamischen Museums befindet sich der Raum mit dem Aleppo-Zimmer. Für einen exotischen Ort wirkt es leider ein wenig steril, was daran liegt, dass es durch große Glasscheiben vom Besucher getrennt ist und dass die originale Decke mit der Kuppel fehlt. Sie befindet sich noch heute im Haus Wakil in Aleppo. Die jetzt vom Bürgerkrieg zerrissene syrische Stadt war damals eine Metropole mit vielen Kulturen und Religionen. Juden, Muslime und Christen lebten friedlich zusammen, Inder, Georgier, Armenier, Venezianer, Holländer und Engländer hielten sich dort auf. Im damals im Zenit seiner Macht befindlichen osmanischen Reich spielte Aleppo eine bedeutsame Rolle.

1912 kaufte der damalige Leiter der islamischen Abteilung des Kaiser-Friedrich-Museums, Friedrich Sarre, die Holzvertäfelung aus einem Kaufmannshaus und brachte sie nach Berlin. Sarre (1865 – 1945) war ein bekannter Orientalist, Archäologe, Kunsthistoriker sowie Sammler islamischer Kunst. Später wurde er Direktor des Islamischen Museums im Pergamon-Museum.
Beim Aleppo-Zimmer handelt es sich um den repräsentativen Empfangsraum eines wohlhabenden Händlers für seine Gäste. Er besteht aus einem rechteckigen, flach gedeckten Bau mit einer Kuppel. Im Inneren gliedert er sich in einen quadratischen Zentralraum, der mit farbigen Marmorplatten ausgelegt war, sowie drei erhöhten Sitzbereichen. In der Mitte des zentralen Bereichs stand ein Brunnen, der heute noch im Haus in Aleppo existiert. Die Holzvertäfelung ist laut Inschriften auf 1600 – 1603 datiert und damit die älteste ihrer Art. Die anderen der wenigen weiteren erhaltenen Exemplare (in New York, Dresden und Potsdam) sind 100 und mehr Jahre jünger. Das Haus gehörte dem christlichen Makler Isa ben Butrus. Trotz des christlichen Auftraggebers ist der Stil der Dekorationen islamisch gehalten, aus der Sprache einiger Inschriften glaubt man einen persischen Künstler erschließen zu können. Er umgeht das islamische Bilderverbot und stellt Szenen aus dem Alten Testament, Herrscherdarstellungen, literarische Motive und Fabelwesen dar. Die christlichen Motive sind von besonderer Bedeutung, weil sie einen Einblick in die Bilderwelt orientalischer Christen geben. Sie beziehen sich allerdings auf Inhalte, die sich so auch im Koran (und natürlich auch in der Tora) finden, so dass das Bildprogramm nicht zu provokativ wirkt.

Der besondere Reiz des Aleppo-Zimmers liegt darin, dass es nicht nur ein hochrangiges Kunstwerk sondern auch eine absolute Rarität ist. Räume dieser Art gibt es an den originalen Orten schon lange nicht mehr, so dass wir mit dem Besuch im Museum uns nicht nur an den exotischen Ort, sondern auch in eine verloren gegangene Vergangenheit versetzen.
08 Expedition auf der Seidenstraße
Die Höhle der Ringtragenden Tauben
Ein besonderes Privileg für die Berliner ist die Möglichkeit, „Reisen“ in exotische Länder, die auch heute noch schwer zu erreichen sind, durch einen Besuch des Ethnologischen Museums zu unternehmen. Dieses ist 2021 in das wieder aufgebaute Berliner Schloss, das Humboldt Forum umgezogen und wird seine Sammlungen im neuen Domizil ab dem Sommer schrittweise öffnen. Dann kann man sich beispielsweise in der indischen Abteilung auf eine Expedition auf der Seidenstraße nach Turfan begeben. Turfan ist eine Oasenstadt an der nördlichen Route der Seidenstraße und gehört heute zum Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang im Westen der Volksrepublik China. Das 1. nachchristliche Jahrtausend, die Blütezeit der Seidenstraße, hinterließ in Turfan bedeutende archäologische Spuren, die im späten 19. Jh. von westlichen Forschern entdeckt wurden. Mehrere Länder, vor allen anderen Großbritannien und Frankreich – aber auch Deutschland, rüsteten Turfan-Expeditionen aus mit dem Ziel, archäologische Beutestücke nach Europa zu bringen.
Zwischen 1902 und 1914 gab es allein vier deutsche Expeditionen nach Turfan, die vom damaligen Direktor der Indischen Abteilung des Museums für Völkerkunde in Berlin, Albert Grünwedel, und dem Turkologen Albert von Le Coq durchgeführt wurden. Bruchstücke von Malereien, Tausende von Kunstobjekten, sowie über 40 000 Handschriften und Handschriften-Fragmente in 16 verschiedenen Sprachen und 26 verschiedenen Schriftarten in unterschiedlichen Buchformen wurden abtransportiert. Sie wurden per Kamel und weiteren Lasttieren bis nach Urumchi, dem nächst gelegenen Bahnhof geschafft und erreichten Berlin per Bahn. Besonderes Geschick zeigten die deutschen Wissenschaftler beim verlustarmen Entfernen von Wandmalereien aus Kulthöhlen. Die Künstler hatten die behauenen Felswände der Höhlen zunächst mit einem Putz aus Lehm, Häcksel und Tierhaaren versehen und das Gemälde darauf aufgetragen. Mit Fuchsschwanzsägen wurden nun rechteckige Putzstücke aus den bemalten Wänden herausgesägt und in extra hierfür vor Ort angefertigten Holzkisten verpackt, ehe sie auf den oben erwähnten Weg nach Berlin gebracht wurden. 1926 eröffnete die neue Turfan-Abteilung im damaligen Berliner Völkerkundemuseum in der Stresemannstraße.
Ein Prunkstück der Sammlung war die aus dem 5./6. Jh. stammende Kulthöhle aus dem buddhistischen Höhlenkloster Kizil, die Höhle der Ringtragenden Tauben. Die vollständige Rekonstruktion des Kultbaus gelang erst nach dem Zweiten Weltkrieg bei der dritten Präsentation, nunmehr im Neubau des asiatischen Museums in Dahlem. Obwohl durch Kriegsverluste etwa 30% des ehemals vorhandenen Materials fehlten, konnte der ursprüngliche Zustand durch die ausgezeichnete schriftliche und fotografische Dokumentation der damaligen Expedition realisiert werden.
Mittlerweile ist das Museum für Asiatische Kunst von Dahlem ins Humboldt-Forum im wieder aufgebauten Berliner Schloss umgezogen. Umgeben von weiteren Beispielen der Turfan-Wandmalereien wird die Höhle der Ringtragenden Tauben (weltweit die einzige rekonstruierte Raumschale einer buddhistischen Kulthöhle) auch am neuen Ausstellungsort das authentische Gefühl jener Expedition vor 100 Jahren vermitteln, das man anhand der ebenfalls präsentierten Aufzeichnungen Albert Grünwedels noch vertiefen kann. Betritt man das geheimnisvoll düstere Innere der Kulthöhle, ist man sofort gefangen von der einmaligen Atmosphäre dieses spirituellen Ortes.

09 Rondo alla Turca, 300 Jahre Türken in Berlin
200 000 nun schon seit Jahrzehnten in Berlin lebende Türken lassen es als absurd erscheinen, mit dem Türkischen verbundene Orte in Berlin als exotisch zu bezeichnen. Doch man besuche nur einmal an den Hauptmarkttagen den „Türkenmarkt“ am Maybachufer in Neukölln oder am Samstagmittag die Geschäfte um die Potsdamer Straße in Schöneberg oder ums Kottbusser Tor in Kreuzberg. Dann wird man sich angesichts des orientalischen Treibens und der Tatsache, als Nicht-Muslim an diesen Orten in der Minderheit zu sein, durchaus an einen exotischen Ort versetzt vorkommen. Wirft man einen Blick in die bald 320 Jahre währende Geschichte der Türken in Berlin, so sieht man, dass hier – und auch im übrigen Mitteleuropa – gerade das Türkische als besonders exotisch galt.

Nach dem Sieg der kaiserlichen Truppen im „Großen Türkenkrieg“ (Belagerung Wiens 1683) kamen Hunderte osmanischer Kriegsgefangene nach Deutschland. „Ungläubige“ Gefangene konnte man ohne allzu große Skrupel versklaven, nach der Rückkehr seinem Herren schenken oder zum eigenen Profit verkaufen. Fürsten und Adlige liebten es, orientalisch gekleidete junge Türken als Hoflakaien zu beschäftigen, denn die Zeit des Barock bevorzugte das Exotische. Zur Chinoiserie und den Hofmohren an den Höfen gesellte sich nun die Türkenmode. 1693 kamen erstmals Osmanen als Kriegsgefangene brandenburgischer Truppen nach Berlin. Aly (* um 1670 im Osmanischen Reich; † 1716 in Berlin) wurde zusammen mit seinem Leidensgenossen Hassan „Kammertürke“ am Hofe von Sophie Charlotte, der Frau des Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg. General von Barfus hatte Aly 1691 beim Gemetzel der Schlacht von Slankamen „erbeutet“ und über Hannover nach Berlin gebracht, wo er konvertierte und den Namen Friedrich Aly annahm. Er heiratete 1694 die Türkin Maruscha, die ebenfalls zum Christentum übergetreten war und den Taufnamen Sophie Henriette annahm. Als „Kammertürke“ (privater Diener der Kurfürstin) erhielt Aly ein stattliches Jahresgehalt von 366 Talern. Als die Königin 1705 in Hannover starb, galt ihr letzter Gruß ihren beiden Kammertürken: „Adieu Aly! Adieu Hassan!“. Der Berliner Historiker Götz Aly (siehe das Kapitel „Südseezauber“) ist übrigens ein Nachfahre Friedrich Alys. 1701, anlässlich der Krönung Friedrichs III. in Königsberg zum König in Preußen (als Friedrich I.) kam der erste offizielle osmanische Diplomat, Azmi Said Efendi, zu Besuch in das Land.
Unter Friedrichs I. Sohn Friedrich Wilhelm I. kam es zu ersten (geheimen) diplomatischen Kontakten mit Sultan Ahmed II., der dem König ein edles Ross als Geschenk sandte. Für 22 „türkische“ (eigentlich muslimisch-tatarische) Lange Kerls, die der in russischen Diensten stehende Herzog von Kurland dem Soldatenkönig schenkte, ließ dieser 1739 im Militärwaisenhaus in Potsdam einen Gebetsraum einrichten und begründete damit erstmals eine muslimische Gemeinde hierzulande. Die Muslime verließen das Land aber schon nach kurzer Zeit wieder.
Unter Friedrich Wilhelms Sohn Friedrich dem Großen wurden 1741 tatarische und bosnische Muslime in das so genannte „Ulanen-Regiment” integriert, das zeitweise bis zu 1.000 Mann umfasste. Nach der preußischen Eroberung Schlesiens strebte der König ein Bündnis mit Sultan Mustafa III. gegen Österreich an. Doch statt dessen kam es 1761 lediglich zu einem preußisch-türkischen Freundschafts- und Handelsabkommen und 1763 zur Eröffnung einer ständigen osmanischen Gesandtschaft in Berlin. Die sich allmählich entwickelnden preußisch-türkischen Beziehungen bewirkten in der Berliner Gesellschaft eine bis in die Kaiserzeit anhaltende Turkomanie.
Am 29. Oktober 1798 verstarb der dritte osmanische Gesandte, Ali Aziz Efendi in Berlin. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. stellte zu seiner Bestattung ein Gelände auf dem Tempelhofer Feld zur Verfügung. Der Trauerzug und die Begräbniszeremonie stellten die erste öffentliche islamische Kulthandlung in Berlin dar und die nie zuvor gesehene Exotik der Kostüme und des Rituals zogen zahllose Neugierige an. Noch ein weiterer türkischer Gesandter wurde hier beigesetzt, dann geriet die Begräbnisstätte in Vergessenheit. Nach der Wiederentdeckung 1836 musste dieser Friedhof einem Kasernenbau weichen. Die türkischen Toten wurden 1866 auf ein am heutigen Columbiadamm Nr. 128 gelegenes Gelände umgebettet, auf dem bereits die muslimischen Gefallenen aus den Freiheitskriegen gegen Napoleon ruhten. 1867 ließen Wilhelm I. und Sultan Abdülaziz einen Obelisken mit einer goldenen Mondsichel auf der Spitze errichten, an dessen Seiten arabisch beschriftete Grabsteine angebracht wurden. Der seitdem als „Türkenfriedhof“ bekannte Ort ging in den Besitz des Osmanischen Reiches und nach dessen Untergang an die Türkische Republik über und ist heute außerdem Standort der Şehitlik-Moschee.
Im 19. Jh. war das Türkische in Berlin ständig präsent. Der Einzug des türkischen Gesandten mit großem Gefolge und reichem Gepränge galt als Sinnbild orientalischen Lebens, das man gern nachahmte. So existierte in der Charlottenburger Berliner Straße (heute Otto-Suhr-Allee) das „Türkische Zelt“, ein Vergnügungsetablissement im exotischen Ambiente. Die Türkenbegeisterung lebte kurz vor dem Ersten Weltkrieg noch einmal besonders auf, als die befreundeten Mächte mit großem Pomp gegenseitige Staatsbesuche inszenierten und deutsche Archäologen durch die großzügige Genehmigungpraxis der Hohe Pforte sensationelle Fundstücke wie die Mschatta-Fassade und das Markttor von Milet nach Berlin schafften (bzw. bereits 1879 den Pergamonaltar).
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges setzten sich einige türkische Verantwortliche für den Genozid an den Armeniern nach Berlin ab, wurden aber von einem armenischen Rachekommando aufgespürt und bei verschiedenen Anschlägen getötet. Man bestattete sie auf dem jetzt Şehitlik-Friedhof genannten Türkenfriedhof. Seinen Namen hatte er von den hier beigesetzten Gefallenen des Weltkrieges, die man als „Märtyrer“ (Şehitlik) bezeichnete. Der osmanische Innenminister Talat Pascha, als Hauptverantwortlicher das prominenteste Ziel der armenischen Attentate, wurde 1943 unter dem Naziregime exhumiert, nach Istanbul überführt und am Denkmal der jungtürkischen Revolution beigesetzt.
Bedeutende Ausmaße nahm das türkische Leben in Berlin erst an, als nach zweitem Weltkrieg, deutscher Teilung und Bau der Berliner Mauer gezielt Arbeitskräfte aus Anatolien angeworben wurden um die durch den Verlust der Grenzgänger geschwächte West-Berliner Wirtschaft zu stärken. Das Konstrukt des „Gastarbeiters“, der nach einiger Zeit freiwillig wieder in die Heimat zurückkehrt, wurde von den Anwerbern selbst verworfen, da sie es für uneffektiv hielten, ständig Arbeitskräfte neu anlernen zu müssen. So entwickelten sich in Gegenden mit geringen Mieten – meist Areale, die der Senat aufgrund der Planungen einer „autogerechten Stadt“ später abreißen wollte – regelrechte Türkenviertel mit eigenen Teestuben, Restaurants und Supermärkten. Moscheen entstanden, allerdings keine Repräsentativbauten, sondern einfache Gebetsräume in Hinterzimmern, Lagerräumen und Industrieetagen. Die deutsche Wiedervereinigung verursachte eine starke Verunsicherung der türkischen Gemeinde, da sie glaubte, dass sich die Deutschen jetzt vorwiegend mit sich selbst beschäftigen würden und die Immigranten dabei noch mehr ins Hintertreffen gerieten.
Nach einer gewissen Zeit der Stagnation gewann die türkische Gemeinschaft jedoch wieder größeres Selbstbewusstsein, was sich u.a. in der Errichtung aufwändigerer Moscheebauten manifestierte. Als Prestigeprojekt sollte das islamische Kulturzentum mit Gebetssaal (Şehitlik-Moschee), finanziert durch die Türkisch-Islamische Union, der Anstalt für Religion (DITIB), Aufsehen erregen. (Mittlerweile ist die DITIB ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, da sie vom Erdogan-Regime gesteuert wird). Die Moschee entstand von 1998 – 2005 anstelle eines 1921/22 erbauten Gebäudes im orientalischen Stil auf dem Grundstück des Türkenfriedhofs. Dabei handelte es sich um das Wohnhaus des Botschaftsimams und Friedhofspflegers Hafız Şükrü Bey, der 1924 starb und hier bestattet wurde. Es war ein schlichter Putzbau, auf einer Grundfläche von 10,58 × 9,35 Metern mit türkisfarbenen Wänden und geschwungenen Fensterpartien, den man 1984/85 zu einer kleinen Moschee mit aufgesetzter Kuppel ausbaute. Die DITIB ersetzte es durch das jetzige Gebäude, entworfen von dem renommierten islamischen Architekten Hilmi Şenalp, der auch die Moscheen in Aşgabat (Turkmenistan) und in Tokio plante.
Şenalps Entwurf zitiert die Großzeit der islamischen Baukunst im 16. und 17. Jahrhundert und ihren Hauptvertreter Mimar Sinan, der die osmanische Architektur auf ihren klassischen Höhepunkt führte. In verkleinerter Form lehnt sich der Entwurf an Sinans berühmte Selimiye in Edirne an. Materialien wie Holz, Marmor und Gips wurden in aufwändiger Gestaltung verwendet. Eine besondere Rolle bei der künstlerischen Gestaltung spielt die Kalligraphie: auf den Platten, die den Übergang zur Kuppel darstellen, sind die Namen Allah, Mohammed, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, Hasan, Hüsseyin höchst kunstvoll verzeichnet.

Muqarnas, stalaktitenartige Gewölbeübergänge, einst ein wesentliches Merkmal islamischer Kunst, heute fast vergessen, werden reichhaltig verwendet. Auf der Hauptkuppel stehen traditionell die Verse Ihlas-i Serif, die Schrift wurde in 23 Karat Goldverzierung ausgeführt. Die Hauptfarbe des Hintergrunds ist statt traditionell kobaltblau hier dunkelgrün, was in früheren Perioden häufiger vorkam. Als Hauptfarben benutzte man Titaniumoxid (weiß), Kobaltblau, Eisenoxid (orange, rot) und Ocker (gelb), andere Farben entstanden durch die Mischung dieser Hauptfarben. Alle Künstler, Maler und Stuckateure kamen extra für den Bau dieser Moschee nach Berlin. Begleitet wurde der Bau von einem kleinen Bauskandal, weil die beiden Minarette statt der genehmigten 28,5 m nun plötzlich 37 Meter hoch waren. Hinzu kam die Anschuldigung, dass das für die Eingangstüren verwendete Elfenbein und Schildpatt nicht auf offiziellem Weg nach Deutschland gelangt wäre.

Nun da die Şehitlik-Moschee fertig ist, stellt sie ein orientalisches Kleinod im Norden da, ein Kleinod, das auch besichtigt werden kann. Auf dem Hof der Moschee tummeln sich an den Besuchstagen zahlreiche Neugierige, andere besichtigen den osmanischen Kuppelbau mit seinen islamischen Elementen von innen. Die Schuhe haben sie am Eingang abgestellt, weitere Vorschriften gibt es für Gäste nicht. Zu diesem exotischen Ort haben sich mittlerweile zwei weitere gesellt: die Khaddija-Moschee in der Tiniusstraße 5 in Heinersdorf, betrieben von der Ahmadiyya-Moslem-Gemeinde und die Umar-Ibn-Al-Khattab-Moschee in der Kreuzberger Wiener Straße 12, die vom „Islamischen Verein für wohltätige Zwecke“ errichtet wurde.
10 Zu den Moguln nach Indien: Ahmadiyya-Moschee
Die Moschee in der Brienner Straße in Wilmersdorf ist das älteste noch bestehende islamische Gotteshaus Deutschlands. 1922 hatte der Inder Maulana Sadr-ud-Din die Berliner Gemeinde der Lahore-Ahmadiyya-Bewegung zur Verbreitung islamischen Wissens gegründet. 1924-28 errichtete K.A. Herrmann für die Gemeinde nach dem Vorbild des indischen Taj Mahal eine Moschee im Mogulstil. Dieser indo-islamische Baustil wurde von den islamischen Eroberern Nordindiens im frühen 16. Jh. kreiert und vereint Elemente teils persischer und arabischer, teils indischer Herkunft. Er verbreitete sich auf dem gesamten Subkontinent, also auch im hinduistischen Indien. Markante Elemente sind geschwungene Kuppeln, Fensterrahmungen in Gestalt von Hufeisen- oder Kielbögen, farbige und dekorative Fassaden, Minarette, Kioske und Türmchen. All das findet sich auch an der Berliner Ahmadiyya-Moschee: Über dem zweifach gestuften Kubus des Unterbaus erhebt sich die zentrale Kuppel, 26 Meter hoch und 10 Meter im Durchmesser, umgeben von Zinnen und Ecktürmchen. Zwei 32 Meter hohe, symmetrisch angeordnete Minarette sind durch Blendmauern mit odem Moscheegebäude verbunden, das 400 Gläubige aufnehmen konnte. Neben dem Gotteshaus baute man noch ein Nebengebäude für den Imam. Einweihung war am 23.3.1928, seitdem war hier Deutsch die Sprache für Predigten und Vorträge. Die Moschee stand „den Muslimen aller mohammedanischen Nationen und aller religiösen Richtungen gleicherweise zum Gottesdienst offen“. 1934 wurde hier das erste deutsche Ehepaar, das den Islam angenommen hatte, vom Imam getraut.

In der NS-Zeit konnte das Regime die Islamische Gemeinde für den Antisemitismus instrumentalisieren. Der Großmufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, der sich vehement für die arabisch-palästinensische Unabhängigkeit im britischen Mandatsgebiet Palästina einsetzte, war 1941 vor den Engländern (in Frauenkleidern) nach Deutschland geflüchtet und stellte sich den Nazis für deren anti-jüdische Propaganda zur Verfügung. Der Zionismus war ihm ein Gräuel und trotz seiner Kenntnis über den millionenfachen Mord an der jüdische Bevölkerung in Europa unterstützte er die Nationalsozialisten und versuchte über seine Kontakte zu den Deutschen, die jüdische Besiedlung Palästinas zu verhindern. In Berlin residierte er in einem arisierten Haus und wurde auf Anordnung Hitlers nicht nur mit einem umfangreichen Mitarbeiterstab unterstützt, sondern auch großzügig entlohnt und erhielt ausgiebig Gelegenheit, in der Ahmadiyya-Moschee Hasspredigten gegen die Juden zu halten. Ab 1943 war al-Husseini mit der Organisation und Ausbildung von islamischen Waffen-SS-Truppen auf dem Balkan befasst und somit in die Kriegsverbrechen in diesem Gebiet zutiefst verstrickt. Kurz vor Kriegsende flüchtete er über die Schweiz und Frankreich in den Nahen Osten, wo er 1974 starb, ohne jemals für seine Verbrechen – die er auch nach 1945 fortsetzte – belangt worden zu sein.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Moschee stark beschädigt, weil deutsche MG-Schützen auf den Minaretten Stellung bezogen hatten und die Anlage dadurch in das Feuer der Roten Armee geriet. Die Minarette stürzten bis auf einen Stumpf ein und die Kuppel erhielt einen Artillerietreffer. Das Ensemble wurde mit Hilfe der Alliierten notdürftig wieder hergerichtet, so dass schon August 1945 in den erhalten gebliebenen Räumen des Gemeindehauses ein erster Gottesdienst für 200 Gläubige abgehalten werden konnte. 1952 wurde die Moschee wieder ihrer Bestimmung übergeben. In den folgenden Jahren tat sich zwar manches Gute zur Restaurierung und Rekonstruktion des Ensembles – so steht die Moschee jetzt unter Denkmalschutz – , aber es blieb bei dem fragmentarischen Nachkriegszustand. Erst 1996 wurde das Haupthaus wieder hergerichtet, 1999 das nördliche und 2001 das südliche Minarett wiederaufgebaut. Das aktuelle Problem ist, dass die Bedeutung der Moschee ständig schwindet. Die Anzahl der Konvertiten zum Islam wie auch der pakistanischen Muslime in Berlin hält sich in Grenzen, während sich die enorm anwachsende türkische Gemeinde neue eigene Moscheen baut.


Seit 2007 fanden deshalb in der Ahmadiyya-Moschee keine regelmäßigen Freitagsgebete mehr statt. Zuletzt waren nur noch knapp 30 Gläubige anwesend. Der Moscheegemeinde fehlte Geld und Personal um die Einrichtung weiter offen zu halten. Nur für besondere Ereignisse öffnete man die Moschee noch, wie beim „Tag des offenen Denkmals“ am 14. September 2008 und am „Tag der offenen Moschee“ am 3. Oktober 2008. Seit 2010 wird jedoch wieder regelmäßig das traditionelle Freitagsgebet mit Predigt um 13.15 Uhr abgehalten. Gottesdienste, Führungen oder Bildungsveranstaltungen können nach Absprache mit dem Berliner Imam Muhammad Ali vereinbart werden. Derzeit wird er von dem englischsprachigen Ahmed Saadat vertreten. Ein Moscheeführer kann bestellt werden. Außerhalb der muslimischen Gemeinde aber wird die Ahmadiyya-Moschee in der deutschen Hauptstadt überwiegend als exotischer Ort oder als „Berliner Taj Mahal“ wahrgenommen.
11 Meditieren in Ostasien: Das buddhistische Haus
Der Berliner Arzt und Schriftsteller Dr. Paul Dahlke (1865 – 1928) hatte auf seinen Asienreisen Interesse für den Buddhismus entwickelt. Um die Jahrhundertwende wurde er selbst Buddhist, übersetzte alte buddhistische Schriften aus dem Altindischen ins Deutsche und gab eine „Neubuddhistische Zeitschrift“ heraus. Auch als Lehrer dieser Religion trat er hervor und begründete ein „Buddhistisches Haus“ auf der Insel Sylt zum Zwecke der Meditation und der Glaubenslehre. Wegen der Zunahme des Tourismus auf Sylt durch den Bau des Hindenburgdammes sah er jedoch die Ruhe zur Meditation gestört und suchte nach einem Ersatzgelände in seiner Heimatstadt Berlin. Er nutzte eine Werbeaktion der Gemeinde Frohnau, die den damals noch rückständigen Ortsteil entwickeln wollte und kaufte einen ganzen Hügel, dessen Erwerb die evangelische Gemeinde wegen der weiten Entfernung zum Bahnhof und des beschwerlichen Aufstieges abgelehnt hatte. In erstaunlich kurzer Zeit ließ er nach eigenen – von asiatischen Bauten inspirierten – Plänen das Hauptgebäude, die Meditationsklausen und den Waschraum durch den Pankower Architekten Max Meyer errichten. 1924 war das Haus und ein Teil der Gartenanlage fertig. 1926 folgte der separate Ausstellungsraum, der auch als Vortragshalle benutzt werden konnte. Diese Halle wurde später zum Tempel im japanischen Stil umgebaut. Von dieser Basis aus betrieb Paul Dahlke die Verbreitung des Buddhismus in Deutschland. Nach seinem Tod 1928 versuchten seine Schwestern zusammen mit Freunden das Haus in seinem Sinne weiterzuführen. (Dahlkes Neffe, der Schauspieler Paul Dahlke (1905 – 1984), spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle).
Die tolerante Lehre des Buddhismus mit ihrem strikten Pazifismus war im Nationalsozialismus unerwünscht und so musste das buddhistische Haus seine Aktivitäten nach 1933 einstellen. Nach dem Krieg wurden Flüchtlinge einquartiert, Gebäude abgerissen und Teile des Gartens verkauft. (Eine der Meditationsklausen dient heute als Garage eines Nachbarn, der Waschraum ist nicht mehr vorhanden). Die Erben Dahlkes hatten keine Mittel, das Haus zu unterhalten und so wurde bereits der Abriss erwogen. Doch wurde im Jahre 1957 Asoka Weeraratna, der damalige Sekretär der German Dharmaduta Society, auf das Haus und seine Rolle als Keimzelle der Verbreitung des Buddhismus in Europa aufmerksam. Er erwarb das Buddhistische Haus von den Erben Dr. Paul Dahlkes und verfolgte ein neues Konzept im Sinne Dahlkes: Das Haus sollte – von Mönchen geleitet – ein offenes Haus zur Verbreitung des Buddhismus sein und jedem zur Meditation zur Verfügung stehen. Die Betreibung als buddhistisches Kloster war in einem Haus, wo männliche und weibliche Personen gemeinsam wohnen können, nicht möglich, so gründete Weeraratna in Ceylon ein eigenes Kloster, in das er auch eintrat und von dem aus einzelne buddhistische Mönche nach Berlin geschickt wurden, die hier buddhistisches Leben im Austausch mit Laienanhängern, die sich den „Fünf Regeln“ untwerfen mussten, pflegten.
Die „Fünf Regeln“ lauten wie folgt:
- Ich gelobe, mich darin zu üben, kein Lebewesen zu töten.
- Ich gelobe, mich darin zu üben, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wird.
- Ich gelobe, mich darin zu üben, keine ausschweifenden sinnlichen Handlungen auszuüben.
- Ich gelobe, mich darin zu üben, nicht zu lügen und wohlwollend zu sprechen.
- Ich gelobe, mich darin zu üben, keine Substanzen zu konsumieren, die den Geist verwirren und das Bewusstsein trüben.
Im Jahre 2000 erlebte das Buddhistische Haus eine Erneuerung in allen Ebenen. Die nötigen Reparaturen wurden unter der Leitung des neuen Verwalters, Tissa Weeraratna, einem Neffen des verstorbenen Asoka Weeraratna, durchgeführt und außer den gewohnten Aktivitäten, wie Vorträgen und Meditationsübungen, sollte ein gezieltes Programm für die Verbreitung der Lehre des Buddhismus in einer breiteren Öffentlichkeit sorgen. Im Sommer 2005 entließ der neue Leiter der German Dharmaduta Society jedoch die hier arbeitenden Mönche und Angestellten. Er führt das Haus nun zusammen mit einem westlichen, englischsprachigen Mönch. Der deutsche Förderverein des Hauses hat sich 2007 neu gegründet. Es finden weiterhin regelmäßig Vorträge, Diskussionen und Retreats statt. Meditationsraum und Bibliothek stehen tagsüber den Besuchern zur Verfügung.

Man betritt das Buddhistische Haus durch das einem ceylonesischen Bau nachempfundenen Elefantentor. Dahinter führt eine steile Treppe mit 73 Stufen zum Haus empor, die den „edlen achtfachen Pfad Buddhas zur Erlösung vom Leid der Vergänglichkeit“ symbolisiert. (Durch 1) rechte Erkenntnis, 2) rechte Gesinnung, 3) rechte Rede, 4) rechte Tat, 5) rechten Lebensunterhalt, 6) rechte Anstrengung, 7) rechte Achtsamkeit und 8) rechte geistige Sammlung soll die Erlösung erreicht werden). Hinter dem Haus gibt es einen Versammlungsplatz und den „Vertiefungsteich“, eine Anlage, welche die vier Versenkungen symbolisiert. (I. Alles Dasein ist leidhaft. II. Leiden entsteht durch Begehren. III. Durch das Aufheben des Begehrens kommt alles Leid zum Erlöschen. IV. Erreichung eines Zustandes frei von Glück und Leid). Im Wohnhaus befindet sich eine umfangreiche Bibliothek. Etwas abseits steht das aus einem Nebengebäude 1974 in ein Gästehaus umgebaute Ceylon-Haus. Im Garten ist eine Steinskulptur der Göttin der Barmherzigkeit, Kannon, zu sehen, die 1959 von der japanischen Stadt Nagoya gestiftet wurde. An einer unbekannten Stelle des Gartens wurde Dr. Paul Dahlke beigesetzt; 1988 brachte man zu seiner Ehrung eine Gedenktafel am Eingangstor an.

„Das Buddhistische Haus“ ist heute nationales Kulturgut und steht unter Denkmalschutz. Zusätzlich sind die umliegenden Grünflächen als Gartendenkmal gelistet.
12 Tee in Tadschikistan
Ein ganz besonders schöner exotischer Ort, vor dem Fall der Berliner Mauer auch vielen West-Besuchern bekannt, war die Tadschikische Teestube im Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft, dem einstigen Palais Donner und späteren Preußischen Finanzministerium. 1974 wurde sie auf der Leipziger Messe als Pavillon für die zentralasiatischen Sowjetrepubliken Usbekistan, Kasachstan und Tadschikistan aufgebaut. Gerüchte besagten, sie entamme einer alten Teestube in Duschanbe, der tadschikischen Hauptstadt, plausibler ist jedoch ein Neubau für den Messezweck, denn nach dem Ende der Messe kehrte sie nicht in die Sowjetunion zurück sondern wurde in das besagte Haus der DSF umgesetzt.

Tadschikistan ist ein zentralasiatisches Hochland, das an Usbekistan, Kirgistan, China und Afghanistan grenzt. Seit 1991 ist es eine unabhängige Republik mit der Hauptstadt Duschanbe, davor war es seit 1929 als Tadschikische Sozialistische Sowjetrepublik Teil der UdSSR. Schon das zaristische Russland hatte es als Kolonie 1868 erobert. Im Mittelalter war es Teil des Kaiserreichs Persien, die Bevölkerung ist ein iranisches Volk und seine Sprache ist ein Dialekt des Iranischen. In der Antike lösten sich Hunnen, Perser und die Griechen unter Alexander dem Großen abwechseld in der Herrschaft ab. Zu Zeiten des Sozialismus war Tadschikistan kein Reiseland und nur wenige Bewohner des Ostblocks dürften es als Touristen je betreten haben. Diese Tatsache machte die tadschikische Teestube zu einem besonders exotischen Ort in Ost-Berlin.
Tadschikische Teestuben sind den türkischen Çayhanes vergleichbar, Orte, in denen die Männer auf dem Boden sitzen, Tavla spielen und Tee trinken – grünen im Sommer, schwarzen im Winter. Diese Tradition stammt aus dem persischen Kulturkreis. Tadschikistan liegt im Hochgebirge des Pamir an der Seidenstraße, über die auch der chinesische Tee kam (tadschikischen Tee gibt es nicht), ein kultureller Schmelztiegel zwischen Ost und West. Für die orientalische reine Männertradition der Teestuben war in der Hauptstadt der DDR aus ideologischen Gründen kein Platz, jedoch die traditionelle Sitzweise auf dem Fußboden – auf weichen Teppichen und auf seidenen, mit Baumwolle gefütterten Kissen – wurde zur Erhaltung des exotischen Flairs natürlich gepflegt. Auch die stimmige Architektur des Raumes unterstützte dies: 6 geschnitzte bauchige Säulen trugen eine Sandelholzdecke mit 16 ebenfalls handgeschnitzten, mit mit floralen Mustern versehenen Balken.
Nach der Wiedervereinigung ging das Haus der Deutsch Sowjetischen Freundschaft mit seinen repräsentativen, klassizistischen Räumen in den Besitz des Landes Berlin über und wird heute unter dem Namen Palais am Festungsgraben kulturell, museal und gastronomisch genutzt. Die tadschikische Teestube konnte unter den neuen Mietkonditionen nicht mehr mithalten und musste am 1.5.2012 schließen. Die Einrichtung des Lokals erwies sich glücklicherweise als nicht unter Denkmalschutz stehend und konnte deshalb von Verwandten der früheren Besitzerin vom Berliner Immobilien Management erworben und ausgebaut werden. Im Kunsthof Oranienburger Straße 27 fanden die Besitzer eine neue Location, wo das zuvor zerlegte Interieur – nun schon zum dritten Male – wieder aufgebaut wurde, diesmal soll es nach dem Wunsch der Besitzer für immer sein. Seit dem 25.2.2013 ist die tadschikische Teestube wieder geöffnet.

Der kundige Besucher kommt sich vor wie am alten Ort, so passgenau wurden die Sandelholzsäulen, die großen Märchenbilder, die Holzdecken, Tische und Sitzkissen in den hohen, dunkelgrün gestrichenen Raum im Kunsthof eingefügt. Neu ist lediglich ein Regal am Eingang: Wer am Boden sitzen möchte, muss sich der Schuhe entledigen, zur Not gibt es Hausschuhe. Das Gefühl des exotischen Ortes stellt sich sofort ein, sobald man die Schuhe abgelegt, sich auf den Seidenkissen platziert hat und wartet, dass der chinesische Tee am Samowar köchelt.
13 Südseezauber
In der kurzen Epoche des deutschen Kolonialismus (von ca. 1884 bis 1918) – die überseeische Welt war ja faktisch bereits unter den alteingesessenen Kolonialmächten aufgeteilt – blieben für das Deutsche Reich nur einige kleinere Gebiete in Afrika und weit entlegene Inseln in der Südsee als „Beute“ übrig. Inselstaaten der Südsee wie Palau, die Karolinen, Marianen und Nauru in Mikronesien und Westsamoa in Polynesien wurden Bestandteil der ab 1899 Deutsch-Neuguinea genannten Kolonie. Von Expeditionen in diese Gebiete brachten Ethnologen wie Augustin Krämer und Johann Stanislaw Kubary dem 1873 gegründeten Museum für Völkerkunde Tausende von ethnografischen Objekten mit, die sie dort getauscht, gekauft oder erbeutet hatten. 1886 bezog das Museum ein eigenes Gebäude in der Königgrätzer Straße (heute: Stresemannstraße), neben dem Martin-Gropius-Bau, das aber nach Beschädigungen durch die Bomben des zweiten Weltkrieges abgerissen wurde. Das Völkerkundemuseum zog in die ehemaligen Magazingebäude in Dahlem und eröffnete dort 1970 die von dem Direktor der Südsee-Abteilung, Gerd Koch, eingerichtete Ausstellung. Nur Nofretete war im alten West-Berlin populärer als die Südseehalle mit den monumentalen Auslegerschiffen von den Inseln Luf und Jaluit (Marschallinseln), sowie dem Männerhaus von den Palauinseln. Der Aufbau dieser Objekte in einer magisch-dunklen Halle mit vielen dazu gehörigen Accessoires gab den passenden Rahmen für eine imaginäre Südseereise im „Völkerkundemuseum“ genannten Gebäude in Dahlem. Nach Vollendung des Berliner Schloss-Neubaus befindet sich die Südseesammlung nun dort und soll der attraktivste Bestandteil des „Humboldt-Forums“ in Berlin-Mitte werden. Aber so unbefangen wie noch in Dahlem wird man die Exponate im neuen Domizil nicht betrachten können, denn mittlerweile ist die Provenienzforschung eines der wichtigsten Gebiete im Bereich der Museen geworden. Wenn es sich bei Exponaten um Objekte aus der Kolonialzeit handelt, ist bei der Recherche, unter welchen Umständen die „Funde“ nach Berlin gelangten, nichts Gutes zu erwarten. Das Humboldt-Forum hat jedenfalls zugesagt, die Provenienz aller fragwürdigen Objekte offen zu legen und Kunstwerke auch gegebenenfalls zurückzugeben, wenn sie unrechtmäßig nach Berlin verbracht wurden.
Aktuell steht das zweimastige Auslegerboot von der Insel Luf in der Debatte. Es ist das Prunkstück in der neuen „Schiffshalle“ im Nordflügel des Schlosses. Das durch seine Größe beeindruckende, mit zwei rechteckigen Segeln – eine seltene Segelform in der Südsee – bestückte Boot war hochseetüchtig und konnte bis zu 50 Personen befördern, die Ladung wurde auf den Plattformen verstaut. Auch als Kriegsschiff konnte es verwendet werden. Zur Trimmung des Schiffes mussten sich Besatzungsmitglieder auf die entsprechenden Plattformen begeben. Im Völkerkundemuseum Dahlem erhielt man auf die Frage nach der Herkunft des Schiffs jahrzehntelang nur die lapidare Auskunft, dass das reich verzierte Boot Anfang des 20. Jh. nach Berlin kam. Es sei das letzte seiner Art und die Bevölkerung von Luf mittlerweile ausgestorben. Heute erfahren wir von Götz Aly*, dass das „Aussterben“ der Inselbevölkerung die Folge einer Strafaktion der deutschen Kolonialherren war und dass es erhebliche Zweifel daran gibt, dass das Boot legal erworben wurde.
* Götz Aly, Das Prachtboot, S. Fischer Verlag 2021


Das auf Taumako gebaute und zu Reisen und Handelsfahrten innerhalb des Archipels der Santa Cruz-Inseln benutzte Hochseeboot mit Ausleger und „Krebsscheren“-Segel ist ebenfalls ein hoch interessantes Objekt. Sein Besitzer gab ihm den Namen „Maunga Nefe“ (ein Berg auf der Insel Vanikoro, die Heimat der Toten-Seelen). Segeltechnisch ist es hoch entwickelt, die merkwürdige Segelform steht den heute gebräuchlichen Segeln in nichts nach. Bei seitlichem Wind kann das Boot in entgegengesetzte Richtung fahren ohne zu wenden, dabei muss nur das Segel vom Bug nach achtern umgesetzt werden. Die Insulaner, denen Mathematik und wissenschaftliche Funktionsberechnung fremd waren, kamen durch ihre ausgeprägte Beobachtungsgabe und der sinnvollen Auswertung von Erfahrungen zu den erstaunlichen Ergebnissen ihrer Schiffsbaukunst. Auch dieses Boot ist das letzte seiner Art, es kam im Jahre 1967 nach Berlin.

Kinder werden den aufgrund der Zeichnungen von James Cook gefertigten Nachbau eines historischen Hochseebootes von Tonga bevorzugen, denn auf ihm dürfen sie nach Herzenslust herumklettern. Vielleicht bekommen sie ja auch etwas von der wunderbaren Präsentation der wie auf einem Strand herumliegenden Boote mit.


In einer stimmigen Anordnung gruppieren sich zwei Fassaden von Kulthäusern und das komplette Männerhaus um einen kleinen Platz und schaffen dadurch ein Ensemble, das den Dorfplatz einer Südseeinsel wiedererstehen lässt. Dominiert wird das Szenario durch das Männerhaus von Palau. Vor über 100 Jahren als 1:2 Modell eines Männerhauses in Palau gefertigt, wurde es zerlegt und zu einer Ausstellung nach Berlin gebracht, anschließend kam es ins Völkerkundemuseum. Da auf den Palauinseln heute nur noch ein einziges originales Männerhaus existiert, besitzt das Berliner Exemplar auch einen hohen Raritätswert. Dach und Bodendielen mussten beim Aufbau des Hauses in Berlin allerdings rekonstruiert werden. Jegliche Vernagelung oder Verleimung der Bauelemente war tabu, das Haus wurde nur durch die gegenseitige Verzapfung der konstruktiven Teile zusammen gehalten. Balken, Planken und die Schauseite des Giebels zeigen Schnitzereien, die sich auf Religion, Mythen, Gesellschaft und Politik der Inseln beziehen.

Ein Männerhaus („bai“) diente als Versammlungshaus einer Gruppe unverheirateter Männer, die einem Häuptling zugeordnet waren. Da die Männer in Altersklassen aufgeteilt waren, gab es mehrere Häuptlinge mit jeweils eigenen bai. Diese Organisationsform war jedoch kein Beleg für eine reine Männergesellschaft. Bis heute gibt es auf Palau die matrilineare Vererbung und damals wurden die Häuptlinge von den Frauen sowohl gewählt als auch wieder abgesetzt. Ledige Frauen durften nur die bai der Männer anderer Dörfer besuchen, zeitweise lebten sie auch dort, um einen Ehepartner zu finden. Dabei erhielten sie Geld für Geschlechtsverkehr mit den ledigen Männern, was als Statusverbesserung der Frau und ihres Clans angesehen wurde. Während der deutschen Kolonialherrschaft verboten die deutschen Missionare diesen Brauch in der irrigen Meinung, es handele sich dabei um Prostitution.
Das Männerhaus darf übrigens (ohne Schuhe) betreten werden, was insbesondere die vielen Kinder freut, die sich von diesem exotischen Ort gefangen nehmen lassen. Gerade im Winter, besonders bei Eis und Schnee, ist es von hohem Reiz, bei einem Besuch von Berlins Mitte eine Reise in solch weit entfernte exotische Länder unternehmen, die auch unter modernen Reisebedingungen noch schwer zu erreichen sind.
14 Exotische Tiere in exotischen Häusern
Als Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts die modernen Großstadtzoos entstanden, spielte die artgerechte Tierhaltung noch nicht die gleiche Rolle wie heute. Den Stadtverwaltungen der aufstrebenden bürgerlichen Städte ging es vielmehr darum, Orte für die Bewohner zu schaffen, in denen die Exotik der Tierarten durch entsprechende Architektur inmitten gärtnerisch gestalteter Anlagen betont wurde und das gewachsene Selbstbewusstsein der Bürger durch derartige Prachtbauten zum Ausdruck gebracht wurde. Hagenbeck’s Tierpark in Hamburg, die Wilhelma in Stuttgart und der Berliner Zoologische Garten sind gute Zeugnisse dafür. Leider haben die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges vieles zum Verschwinden gebracht, dennoch kann man auch heute noch eine wunderbare exotische Reise im Berliner Zoo unternehmen.
Nicht viele von den Tierhäusern, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert entstanden, sind erhalten geblieben. Sie wurden von der Architektenelite des Deutschen Kaiserreichs entworfen: bis 1884 durch die Sozietät Ende & Böckmann, danach durch Kayser & Großheim sowie zuletzt von Zaar & Vahl. Das 1871-72 von Hermann Ende und Wilhelm Böckmann erbaute Antilopenhaus steht noch, daneben der Persische Turm, das Arabische Pferdehaus und das Bisonhaus. Sie sollten durch ihre fremdländischen Baustile auf die Heimat der dort untergebrachten Tiere hinweisen. 1880 wurde ein weiterer (provisorischer) Eingang an der heutigen Budapester Straße eingerichtet, nachdem man das Gelände vorher nur über das Löwentor am Hardenbergplatz betrat. 1898-99 erbauten Carl Zaar und Rudolf Vahl neben dem Aquarium das von steinernen Elefanten getragene Elefantentor mit geschwungenem Dach, grün glasierten Ziegeln und vergoldeten Ornamenten nach japanischen und siamesischen Vorbildern. Dieses im Krieg zerstörte Wahrzeichen des Zoologischen Gartens wurde 1984 wieder hergestellt und fungiert seitdem als Haupteingang, durch den wir unsere exotische Reise starten.
Prunkstück der von Dr. Heinrich Bodinus, dem ersten hauptamtlichen Zoodirektor errichteten charakteristischen Stilbauten ist das 1871 eröffnete prachtvolle Antilopenhaus mit seinen vier Minaretten im Stil von 1000 und 1 Nacht.


Als eine der damaligen Hauptsehenswürdigkeiten Berlins gab es 1872, nur wenige Monate nach der Eröffnung, sogar den Rahmen für ein Drei-Kaiser-Treffen ab. Kaiser Wilhelm I., Kaiserin Augusta, Kaiser Franz Joseph von Österreich und Zar Alexander II. von Russland trafen sich hier am 8.9.1872 zum Frühstück. Ungeachtet der harmlosen Umgebung ging es um erzkonservative Dinge wie gemeinsame Maßnahmen zur Unterdrückung der revolutionären Bewegungen in den drei Kaiserreichen, die ablehnende Haltung gegenüber dem republikanischen Frankreich und eine russisch-österreichische Verständigung über die Beibehaltung des Status quo auf dem Balkan.

Verziert mit arabischen und orientalischen Motiven, steht das Antilopenhaus beispielhaft für die arabisch-afrikanische Heimat der Tiere. Neben den Antilopen sind auch die Giraffen in halbrunden Käfigtrakten untergebracht, die um den Besucherbereich mit einem verglasten Palmenhaus in der Mitte angeordnet sind. Eine 1874 in der Loggia angebrachte Wandmalerei „Antilopenhetze im Sudan“ wurde 1891 auf Fayenceplatten übertragen, jedoch im Zweiten Weltkrieg zerstört. Gemeinsam mit den minarettähnlichen Aufsätzen des Gebäudes wurde sie 1984-86 wieder hergestellt.

Ein weiterer Stilbau war das erst 1956 abgerissene ägyptische Straußenhaus, das leider der Erweiterung des Hardenbergplatzes weichen musste. Dafür blieben das Afrikanische Tierhaus für pferdeartige Tiere und der Persische Turm für pferdeartige Tiere erhalten. Sie stammen von Carl Zaar und Rudolf Vahl und gehen auf das Jahr 1909-10 zurück. Der persische Turm, verziert mit Fayencefries und Kuppeldach, sieht wie das Minarett einer persischen Moschee aus, während das Arabische Pferdehaus mit Zinnen, Loggia und einem hölzernen Balkon die arabische Architektur in Ostafrika zitiert.

Das 1904-05 ebenfalls von Zaar und Vahl erbaute Bison- und Wisenthaus, ein russisches Blockhaus mit farbenfrohem Dekor und ein mit indianischen Motiven bemaltes Bretterhaus, wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und in den 1980er Jahren rekonstruiert.

15 Expedition in die Tropen: Tropenhaus im Botanischen Garten
Das Große Tropenhaus im Botanischen Garten Berlin-Dahlem gehört zu den bedeutendsten und größten Gewächshäusern der Welt. Seit mehr als 100 Jahren zieht es jedes Jahr große Besuchermengen an. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass man hier eine Fülle von seltenen exotische Pflanzen bei einem Spaziergang entdecken kann, ohne dafür mehrere Expeditionen in weit entfernte tropische Länder unternehmen zu müssen.
Die Stahl-Glas-Konstruktion wurde 1905 bis 1907 nach Plänen des Königlichen Baurats Alfred Koerner und des Statikers Heinrich Müller-Breslau gebaut. Als innovativ galt damals vor allem die von Müller-Breslau gewählte Konstruktionsweise, nach der die riesigen Dreigelenkbögen des stählernen Tragwerkes nach außen gelegt und die gläserne Fassade innen eingehängt wurde. Dies machte es möglich, im Inneren ohne Stützen und Pfeiler auszukommen.
Im Zweiten Weltkrieg gab es schwere Schäden durch Bomben, deren Druckwellen die Scheiben zum Platzen brachten. Fast alle tropischen Pflanzen erfroren, lediglich die Palmfarne wurden durch die damaligen Gärtner gerettet. Die bis zu 200 Jahre alten Pflanzen-Methusalems haben jetzt ihren Platz über der neuen Grotte mit Wasserfall. Der Wiederaufbau des Botanischen Gartens begann 1949 und im folgenden Jahr konnte schon ein Gewächshaus eröffnet werden. 1958 gab es bereits neun Gewächshäuser, aber erst 1968 konnte als letztes Gebäude das Große Tropenhaus nach fünfjähriger Bauzeit eröffnet werden.
Die gesamte Anlage wurde jetzt mit moderner Technik ausgestattet. Anstelle des gebräuchlichen, aber schlechte Dämmwerte aufweisenden Silikatglases wurde Acrylglas verwendet, das günstigere Eigenschaften aufwies: es absorbierte weniger UV-Licht, die Wärmeleitfähigkeit war geringer, das Material war leichter und konnte besser geformt werden, wodurch größere Scheiben (1 × 2 Meter) möglich wurden. Ein Nachteil des Materials zeigte sich jedoch anlässlich eines Brandes im Juli 1969, als die nicht feuerfesten Scheiben sich verformten oder schmolzen. Glücklicher Weise konnte man die Schadstelle noch vor dem Kälteeinbruch wieder schließen, die Wiedereröffnung des Tropenhauses erfolgte im Juni 1970.
40 Jahre nach der Wiedereröffnung wurde eine erneute Grundsanierung des Tropenhauses nötig. Durchgerostete Aufhängungen der Deckenleuchten und die marode Heizungsanlage hatten bereits zweimal eine Schließung des Hauses erfordert. Deshalb beschloss das Berliner Abgeordnetenhaus 2006 eine 16 Mio. € teure Generalsanierung, die nach dem Umsetzen der Pflanzen in andere Gewächshäuser und in ein eigens errichtetes provisorisches Gewächshaus bis 2009 dauerte. Das Tropenhaus bekam seine kleinteilige Silikatverglasung zurück und zusätzlich eine Fassadenheizung, die in den Fensterprofilen verläuft. So beschlagen die Fenster nicht mehr und die Pflanzen bekommen genügend Licht, während die Fassadenheizung dafür sorgt, dass nur noch halb so viel Energie wie vor der Sanierung verbraucht wird. Zum Energiesparen wurde auch eine spezielle Klimaanlage eingebaut: Zwei 17 Meter hohe, als abgestorbene Urwaldbäume getarnte Türme sind mit latenten Wärmespeichern ausgerüstet. Über Ventilatoren wird die aufsteigende Warmluft tagsüber angesaugt und unten wieder eingeblasen. Nachts wird die kühlere Raumluft über die tagsüber aufgewärmten latenten Wärmespeicher geführt und dadurch ohne Energiezufuhr erwärmt.

Im Frühsommer 2009 zogen die Pflanzen wieder ein, die für drei Jahre ausquartiert worden waren: die Palmen und Sträucher, die Ficusbäume und Bananengewächse, der Riesenbambus und die 150 Jahre alten Palmfarne, die schon den Umzug des Botanischen Gartens von Schöneberg nach Dahlem Ende des 19. Jahrhunderts mitgemacht hatten. Exotische Gewächse in unzähligen Grüntönen verwandeln den Ort in ein kleines Paradies, in dem auch Grotte und Wasserfall nicht fehlen. Einige Pflanzen haben schon wieder Fruchtstände ausgebildet – ein echtes Wunder, wo doch Ortswechsel und Erschütterungen Gift für sie sind. Alles ist wieder an seinem alten Platz und ermöglicht dem Besucher eine exotische Reise: Durch die Karibik gelangt er nach Zentral- und Südamerika, dann nach Afrika, Asien und Ozeanien. Hoffentlich werden auch die alten Veranstaltungen wieder aufgenommen wie Konzerte unter Palmen und Lesungen (über exotische Reisen) im Urwald.
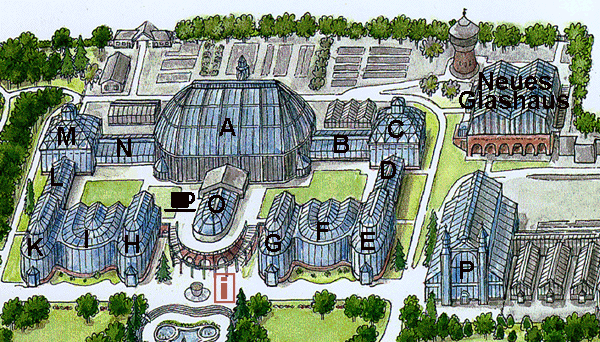
Im Freigelände des Botanischen Gartens kann man einen kleinen Abstecher nach Fernost machen, allerdings unter europäischen Klimabedingungen: Zum Japanischen Garten mit dem Japanischen Pavillon.
16 Architektur der Wüste
Botschaften weit entfernter Länder sind schon per se exotische Orte, sollen sie doch die Verbindung des fremden Landes, das sie vertreten mit der Hauptstadt, in der sie residieren, herstellen. In der Botschaft wird man immer Menschen des fernen Landes vorfinden, oftmals bieten die Botschaften auch Kulturprogramme an, die die Eigenheiten des vertretenen Landes den Hauptstädtern nahebringen sollen. In selteneren Fällen ist das Botschaftsgebäude selbst ein Beispiel für den Baustil des vertretenen Landes.
Nach der deutschen Wiedervereinigung gab es einen erheblichen Zuzug an Botschaften nach Berlin. Die wenigsten Staaten konnten Gebäude weiter nutzen, die sie schon vor dem Krieg besessen hatten, denn die schweren Zerstörungen Berlins im Zweiten Weltkrieg betrafen insbesondere das Diplomatenviertel. Zwei repräsentative Bauten haben sich dort teilweise erhalten, die Botschaften der „Achsenmächte“ Italien und Japan. Beide sind in erster Linie faschistische Bauten, geplant im Büro Albert Speers in einem pseudo-klassizistischen Baustil. Aber die Botschaft von Italien erinnert immerhin ein wenig an einen römischen Palazzo, verbunden mit den darin stattfindenden italienischen Kulturevents stellt sie dann doch ein genuines Stück Italien in Berlin dar. Anders die japanische Botschaft: Ihr Äußeres zeigt keine japanischen Anklänge, der Eindruck der faschistischen Architektur herrscht vor und obendrein ist das Gebäude nicht einmal original, denn es war im Laufe der Jahre so heruntergekommen, dass es komplett abgerissen und als Kopie wieder errichtet werden musste.
Die meisten in Berlin vertretenen Staaten besitzen ein repräsentatives, gemietetes Botschaftsgebäude oder errichteten moderne Neubauten, wie insbesondere die USA, Großbritannien und Frankreich. Ein Sonderfall sind die arabischen Ölstaaten, die vor dem Krieg nur als Mandatsgebiete Großbritanniens oder Frankreichs existierten und keinerlei alte Immobilien besaßen. Insbesondere die kleinen Emirate, Ministaaten mit einem sagenhaften Reichtum haben ein starkes Bedürfnis, die gestiegene Bedeutung ihrer Länder durch den exotischen Stil ihrer Botschaftsgebäude zu unterstreichen.
Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate
1971 machten sich sieben arabische Scheichtümer von Großbritannien unabhängig und schlossen sich zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit der Hauptstadt Abu Dhabi zusammen. Heute präsentieren sich die Emirate nicht nur als ernst zu nehmende politische Interessengemeinschaft mit hoher Wirtschaftskraft, sondern auch als attraktives touristisches Ziel mit großen kulturellen Ambitionen. Zur Zeit wetteifern sie um die höchsten und prächtigsten Hotelbauten der Welt und andere gigantische Neubauprojekte. In diesem Zusammenhang muss man auch die neue Botschaft der VAE im Berliner Diplomatenviertel verstehen.

Obwohl von deutschen Architekten errichtet, präsentiert sie sich an der Hiroshimastraße im Diplomatenviertel wie ein Palast aus „Tausendundeiner Nacht“. Über rechteckigem Grundriss erhebt sich das mit Sandstein verkleidete vierstöckige Gebäude mit einem auffallenden Mittel- und zwei Eckrisaliten. Im Inneren wird es durch einen Mittelgang in Gebäudehöhe in zwei Teile geteilt. Hat man das hohe Eingangsportal passiert, folgt die lang gestreckte Empfangshalle, die wiederum in eine große runde Halle in der Mitte des Hauses mündet. Diese von Säulen getragene zentrale Halle besitzt ein farbiges Glasdach mit dem typisch arabischen achteckigen Stern, mashrabia, der als Dekorationselement innen und außen immer wieder in Erscheinung tritt. Höhepunkt und Abschluss findet der Mittelgang im beeindruckenden großen Festsaal an der Gartenseite des Hauses. Er ist an drei Seiten von Galerien umgeben, die von Säulen mit vergoldeten Kapitellen getragen werden und öffnet sich großflächig verglast nach außen. Die Büroräume sind in den oberen Geschossen angeordnet. Ziel der Architekten war es, mit dem Botschaftsbau eine „neue Interpretation der traditionellen arabischen Architektur“ zu schaffen.
Auch die Residenz des Botschafters in der Winklerstraße in Grunewald verwendet neo-arabische Stilformen und ist von erstaunlicher exotischer Pracht.
Botschaft von Katar
Katar hat nur 800 000 Einwohner, von denen sogar nur 120 000 „echte“ Staatsbürger des Landes sind und zählt aufgrund der größten zusammenhängenden Erdgasvorkommen zu den zehn reichsten Ländern der Welt. Für die Bürger sind Elektrizität, Wasser und Gesundheitsversorgung kostenlos. 2022 will das Mini-Land die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten. So versteht sich der 18 Millionen Euro teure Botschaftsbau auch als Aushängeschild zum Aufbau von Wirtschaftskontakten und zur Tourismuswerbung.

Das 2 300 Quadratmeter große, imposante Gebäude mit dem charakteristischen Turm an der Eingangsseite an der Hagenstraße in Grunewald ist mit mattiertem spanischem Granit verkleidet, der wie Marmor wirken soll. Hinter dem Eingang, in einer zweistöckigen Halle, werden die Gäste empfangen. Zwei Villen an den beiden Enden des Baus beherbergen die Botschaftsangestellten. Das Imposanteste im Innern ist der mit venezianischem Putz und Säulen geschmückte Speisesaal. Wer zu Gast beim Botschafter ist, kann im Botschaftsgebäude übernachten. Die zwei Gästewohnungen rechts und links des Turms sind durch einen Wandelgang miteinander verbunden.

Auch die Residenz des Botschafters, direkt um die Ecke in der Clayallee, ist sehr prächtig, im gleichen Stil wie die Botschaft, nur etwas kleiner. 1800 Quadratmeter Wohnraum stehen der Botschafterfamilie zur Verfügung. Die Loggien vor den Fenstern sind allerdings nur Anklänge an die Wüstenarchitektur, denn in Berlin ist es die meiste Zeit des Jahres zu kalt dafür. Deshalb befindet sich der Swimmingpool auch nicht nicht draußen, sondern im Keller des Gebäudes.
Botschaft von Saudi Arabien
Die saudische Botschaft im Diplomatenviertel an der Tiergartenestraße besteht aus einer Synthese von moderner und islamischer Architektur, soll aber ebenfalls die arabische Architektur repräsentieren. Das Haus verfügt über zwei Gebäudeteile, einen den Grundstücksgrenzen folgenden trapezförmigem Haupttrakt und eine zur Tiergartenstraße vorgesetzte halbe Rotunde. Zwischen beiden Bauteilen befindet sich ein verglastes, 15 Meter hohes Atrium, in dem die Erschließung der einzelnen Etagen über gläserne Brücken erfolgt.

Die Botschaft hat fünf Stockwerke und zwei Kellergeschosse. Im Erdgeschoss liegen die höher frequentierten Nutzungsbereiche wie Konsulat, Bibliothek und Empfang, die Räumlichkeiten des Botschafters befinden sich zurückgezogen im Dachgeschoss. Zwischen dem Haus und der Tiergartenstraße liegt ein Wasserbecken, dessen Spiegelungen in die Fassadengestaltung mit einfließen. Als besonderes Kennzeichen des Gebäudes sind matt silbrige Edelstahlelemente mit filigraner arabischer Ornamentik an der halbrunden Straßenfassade angebracht – bei Tageslicht ergeben sie unterschiedliche Lichtspiele und am Abend erhalten sie durch spezielle Lichttechnik eine effektvolle Beleuchtung. Ein westlich liegendes Eingangsportal ist mit ähnlichen arabischen Schriftzügen ausgestattet.
Bei der Eröffnung am 9. Februar 2011 beschwor der Bundeaußenminister die guten Beziehungen beider Länder und hob als Aspekt besonders Wissenschaft und Bildung hervor. Er lobte die Bemühungen des saudischen Königs Abdullah um die Diversifizierung der Wirtschaft seines Landes (d. h. die Bemühung um Unabhängigkeit vom reinen Ölgeschäft) und um die Bildung, vor allem für Frauen. „Die Freundschaft unserer Länder erträgt das offene Wort, wenn es in der Melodie des gegenseitigen Respekts gesprochen wird“. Leider wird dieses offene Wort nicht gesprochen, wenn es um saudische Innenpolitik wie die Verweigerung des Führerscheins für Frauen, die Praktizierung der Scharia als Rechtssystem und die schier unglaubliche Entführung und Ermordung eines Journalisten auf „höchsten Befehl“ geht.
17 Alt-Russland: Das Haus des Nikolaus und die Auferstehungskathedrale
Russen in Berlin
Brandenburg/Preußen unterhielt traditionell gute Beziehungen zum russischen Zarenreich, seit Zar Peter der Große es zum Westen hin geöffnet hatte. 1706, zur Zeit der Einrichtung einer russische Gesandtschaft in Berlin war die russische Gemeinde bereits so zahlreich, dass sie eine eigene Kirche benötigte. Die Gesandtschaft richtete deshalb in ihrem Gebäude, das im 18. Jh. mehrmals umzog, einen orthodoxen Kultraum ein. Während der napoleonischen Kriege verbesserten sich die preußisch-russischen Beziehungen weiter, weil Friedrich Wilhelm III. die erzwungene Koalition mit den Franzosen aufkündigte und zusammen mit Zar Alexander I. Napoleon besiegte. Die nach Alexanders Tod 1826/27 errichtete Russische Kolonie Alexandrowka in Potsdam (s.u.), ist ein Zeugnis dieser guten Beziehungen. Schon vorher, 1819, zum Anlass der Heirat seiner Tochter Charlotte mit Nikolaus, dem Bruder Alexanders I., hatte Friedrich Wilhelm III. seinem Schwiegersohn gegenüber der Pfaueninsel ein Blockhaus in russischem Stil bauen lassen. 1837 ließ Nikolaus, der mittlerweile Zar geworden war, ein Grundstück Unter den Linden kaufen und mit einem repräsentativen Palais bebauen, das bis 1917 die russische Gesandtschaft aufnahm. Nach der Oktoberrevolution wurde es Sitz der Delegation des sowjetischen Russlands, aber nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1939 von den Nazis enteignet und als Internierungslager und später als Sitz des „Ostministeriums“ missbraucht. Das im zweiten Weltkrieg zerstörte Palais wurde nach dem Krieg an der selben Stelle als Sowjetische Botschaft wieder aufgebaut und fungiert heute als Botschaft der Russischen Föderation.

Nach der Russischen Revolution strömten zunächst Hunderttausende von Flüchtlingen nach Berlin und siedelten sich in den westlichen Bezirken an, Charlottenburg erhielt vorübergehend sogar die scherzhafte Bezeichnung „Charlottengrad“. Viele der Emigranten zogen später weiter nach Westen, aber die Verbliebenen strebten nach einer eigenständigen orthodoxen Kirche. Zwar hatte die russische Gemeinde bereits seit 1890 ein Friedhofsgelände in Tegel erworben und dorthin 4 Eisenbahnwaggons mit 4000 Tonnen russischer Erde transportiert. 1894 weihte man noch ein kleines Kirchengebäude ein, das sich mit seinen fünf zwiebelturmförmigen Kuppeln architektonisch an die Basiliuskathedrale in Moskau anlehnt. Doch die geringe Größe des Gotteshauses und seine Abgelegenheit ließen es wünschenswerter erscheinen, einen Kirchenbau im Berliner Neuen Westen zu besitzen, so dass es 1938 schließlich zum Bau der Auferstehungskathedrale am Hohenzollerndamm kam.

Blockhaus Nikolskoe
Dieser, von den Berlinern hartnäckig falsch als Nikolskö ausgesprochene Ort ist ein genuines Stück Russland in Berlin. Bei korrekter Aussprache des russischen e ergibt sich der Name Nikolskoje = dem Nikolaus zu Eigen; er steht für ein Blockhaus in russischem Stil, angeregt durch einen Entwurf Carlo Rossis für ein – nie realisiertes – russisches Dorf Glasowo im Park von Pawlowsk. Soldaten des preußischen Garde-Pionier-Bataillons unter Leitung des Hauptmanns Adolf Snethlage (1788–1856) – der später auch die Russische Kolonie Alexandrowka erbauen sollte – errichteten das Gebäude, das (anders als die nur auf Blockhaus „getrimmten“ Fachwerkbauten der Alexandrowka) in „echter“ Blockhaus-Manier konstruiert wurde. Wie in der Alexandrowka sorgen reiche Holzschnitzereien für den stilechten Eindruck des russischen Hauses, wie man es aber – nach 60 Jahren Sozialismus – in Russland heute kaum noch findet. Das Gebäude fungierte ursprünglich als Teestube, doch nach dem Tod des kaiserlichen Besitzers wurden die Matrosen der königlichen Fregatte „Royal Louise“ im Untergeschoss und der Aufseher Iwan Bockow in einer kleinen Wohnung im Obergeschoss untergebracht. Bockow ist der Vorläufer der Gastronomen, die das Haus bis heute nutzen; entgegen der Anweisungen des Hofmarschallamts betrieb er eine Gastwirtschaft, in der er gelegentlich auf dem Klavier spielte und das Publikum tanzte. Bei einer Kontrolle verhängte das Rent-Polizei-Amt Potsdam eine Geldstrafe wegen des fehlenden Gewerbescheins. Nach dem Ersten Weltkrieg ging das Blockhaus in Staatsbesitz über und wurde jetzt dauerhaft bewirtschaftet. 1984 richtete ein Brandanschlag schwere Zerstörungen an, wobei ein Toter zu beklagen war. Dach und Giebel waren vollständig verbrannt. Ab 1985 wurde das Haus originalgetreu wiederaufgebaut und dient seither wieder als Gaststätte.

Auferstehungskathedrale
Die erste von der Emigrantengemeinde nach 1917 selbst verwaltete russische Kirche entstand im Mariannenhaus in der Nachodstraße 10, wo die Gemeinde eine Schule betrieb. Da der in zwei Klassenzimmern eingerichtete Saal nicht besonders attraktiv war, zog man in einen großen Wohnkomplex am Hohenzollerndamm/Ecke Ruhrstraße um, wo die Orthodoxe Kathedrale abermals im Inneren eines anderen Zwecken dienenden Gebäudes unterkam und 1928 eingeweiht wurde. In der NS-Zeit wollte die Deutsche Arbeitsfront diesen Gebäudekomplex selbst nutzen und stellte der Russischen Kirche deshalb unweit des alten Standorts am Hoffmann-von-Fallersleben-Platz ein eigenes Grundstück zur Verfügung. Die Deutsche Staatsbauverwaltung führte den Bau nach Entwürfen und unter der Bauleitung des Ministerialrates Karl Schellberg in historisierenden Formen aus, wobei er sich vom Dreifaltigkeits-Kloster in Sagorsk inspirieren ließ. Die Russisch-Orthodoxe Christi-Auferstehungskathedrale ist eine Kreuzkuppelkirche in russisch-byzantinischem Stil, erkennbar an der erhöhten Zentralkuppel mit runder Laterne und Zwiebelhaube, sowie an den vier kleineren Zwiebeltürmchen in den Dachzwickeln. Im durch Rundbogenarkaden geteilten dreischiffigen Inneren trennt eine prachtvolle Ikonostase (Bilderwand) – sie stammt ursprünglich aus einer Kirche bei Warschau – den Altarraum (Bema) vom Gemeinderaum (Naos). 1938 wurde das Gebäude eingeweiht und hatte das Glück, im Krieg kaum beschädigt zu werden. Schon am 25.11.1945 konnte wieder das erste Kirchenkonzert stattfinden, in dem der vereinigte Kirchenchor der Kathedrale und der Kirche Nachodstraße 10 sang. 1952 wurde die Auferstehungs-Kathedrale nach umfangreichen Wiederherstellungsmaßnahmen neu geweiht. Heute ist sie die Hauptkirche der Russischen Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats in der Diözese Berlin und in ganz Deutschland. Regelmäßig finden Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse, Seelenämter, Bittgebete und Hauseinweihungen statt. Schätzungen zufolge leben in Berlin wieder rund 100 000 Russen. Darunter sind Russlanddeutsche, jüdische Einwanderer, die als sogenannte Kontingentflüchtlinge in Deutschland sofort eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten, und Russen, denen es in ihrer Heimat zu ungemütlich geworden ist.

18 Erfundene Exotik: Neue Synagoge
Die orientalisierende goldene Kuppel der Neuen Synagoge, die jetzt wieder das Stadtbild der Berliner Mitte prägt, erweckt den Eindruck, das Gebäude sei nach Pogromnacht und Kriegszerstörung wieder entstanden, jedoch ist das eine Täuschung; was dort so glänzt, ist lediglich die Fassade des berühmten Bauwerks. Der eigentliche Synagogensaal, der ehemals größte Teil des Komplexes, wurde nach den Kriegszerstörungen abgerissen und wird jetzt durch einen großen Hof ersetzt, der sich hinter der Fassade befindet. Architekt der Neuen Synagoge war der Berliner Eduard Knoblauch, der zuvor bereits die Alte Synagoge in der Heidereutergasse vergrößert hatte und in den Jahren 1859-66 das jetzige Gebäude errichtete.

Der exotische Stil des Gebäudes war anfangs umstritten. Das Problem lag darin, dass es einen eigentlichen jüdischen Baustil für Synagogen nicht gibt. Bei historischen Synagogen richtete sich das Aussehen in erster Linie an den baulichen Gegebenheiten (Zweckbestimmung der Räume u. Ä.) aus. Meistens hatten die Gemeinden wenig Geld oder unterlagen Restriktionen über das Aussehen des Gebäudes, welches vor allem niemals prachtvoll wirken durfte. So waren diese Bauten klein und bescheiden und griffen nur verhalten den zu ihrer Erbauungszeit herrschenden Baustil auf. Diese Bedingungen hatten sich zur Mitte des 19. Jh. jedoch geändert. Die Juden galten jetzt als Staatsbürger, hatten einen 40-jährigen Emanzipationsprozess hinter sich und wollten ihre neugewonnene soziale Stellung auch durch die Pracht ihrer Gotteshäuser dokumentieren.

Knoblauch wählte für seinen Entwurf maurische Formen, die die Assoziation an die Architektur Cordobas wecken sollte, wo die Emanzipation der Juden und ihre relative religiöse Gleichrangigkeit mit dem Islam und dem Christentum im frühen Mittelalter einen Höhepunkt erlebt hatten. Kritiker aus dem Kreis des liberalen Judentums warfen dem Architekten vor, dass er durch die Exotik des Entwurfs geradezu eine Fremdartigkeit des Judentums beschwor, die das liberale Judentum loswerden und durch den assimilierten jüdisch-deutschen Staatsbürger ersetzen wollte. Sie hätten ein Gebäude in romanischen oder gotischen Formen bevorzugt und gern an die mittelalterliche Tradition des Judentums im Rheinland angeknüpft, wo die Synagogen in Worms und Speyer im „deutschen“ Baustil errichtet wurden. Letztlich waren aber auch die Kritiker mit dem repräsentativen Äußeren des Bauwerks zufrieden, war es doch die größte und schönste aller deutschen Synagogen. Erstaunlich ist, dass annähernd zur selben Zeit der Wiener Architekt Ludwig Förster einen stilististisch sehr ähnlichen Entwurf für die Große Synagoge in Budapest vorlegte. Das zeigt, dass die Fokussierung auf exotischen Baustil für jüdische Einrichtungen eine europäische Dimension hatte.

Der Komplex ist in die Blockrandbebauung der Oranienburger Straße eingebunden – frei stehende Gebäude waren im protestantischen Preußen in jener Zeit noch den evangelischen Kirchen vorbehalten – aber die Wahl eines renommierten Architekten und der exotische Baustil mit der goldenen Kuppel zeugten davon, dass die Bauherren hier ein Zeichen setzen wollten. Nach Knoblauchs Tod 1865 setzte der königlich-preußische Oberbaurat August Stüler die Bauausführung fort. Moderne Eisenkonstruktionen wurden im Innern verwendet: Die Deckengewölbe des Synagogensaales mit seinen 3200 Plätzen ruhten auf schlanken Eisenstützen; die filigrane eiserne Kuppelkonstruktion entwarf Johann Wilhelm Schwedler, ein renommierter Ingenieur und Schöpfer von Brücken, Gasometern und Bahnhofshallen. Um das verwinkelte Grundstück voll auszunutzen, entstand ein mehrfach in der Hauptachse gebrochener Grundriss, diese Unregelmäßigkeit war aber durch die geschickte Anordnung der Räume kaum merkbar. Die Neue Synagoge galt als der bedeutendste jüdische Kultbau Deutschlands.
Selbstverständlich richteten sich die Aktivitäten der NS-Pogromnacht auch gegen dieses auffällige Symbol des Judentums. Allerdings verlief die Aktion nicht so, wie an unzähligen anderen Orten: Den Brandstiftern trat der örtliche Reviervorsteher Wilhelm Krützfeld entschlossen entgegen, verwies auf Denkmalschutz und Brandgefahr für Wohnungen „arischer Volksgenossen“ und ließ bereits gelegte Brände wieder löschen. Ein halbes Jahr später wurde die Synagoge bereits wieder genutzt, die Kuppel aber nach Kriegsausbruch mit Tarnfarbe übermalt. Am 30.3.1940 endete die Nutzung als jüdisches Gotteshaus, das Gebäude wurde enteignet und darin ein Lager für das Heeresbekleidungsamt III eingerichtet. 1943 zerstörte ein heftiger Bombenangriff den Hauptsaal und den rechten Turm und beschädigte die Kuppel schwerwiegend. Die Ruine blieb für die nächsten 25 Jahre ungenutzt stehen.

Die Leidenszeit des Gebäudes ging jedoch noch weiter: 1958 ließen die DDR-Behörden die Ruine des Synagogensaals und die beschädigte Kuppel oberhalb des Tambours abtragen. Angesichts einer jüdischen Gemeinde von ca. 100 Mitgliedern konnte man sich ein Wiederaufleben jüdischen Lebens im Arbeiter- und Bauernstaat nicht vorstellen. 1966 wurde die Ruine zur Gedenkstätte erklärt, worauf eine von der jüdischen Gemeinde angebrachte Tafel hinweist. Sie trägt die Inschrift: Diese Synagoge ist 100 Jahre alt und wurde am 9. November 1938 IN DER KRISTALLNACHT von den Nazis in Brand gesteckt. Während des II. Weltkrieges wurde sie im Jahre 1943 durch Bombenangriff zerstört. Die Vorderfront dieses Gotteshauses soll für alle Zeiten eine Stätte der Mahnung und Erinnerung bleiben. VERGESST ES NIE.
Gegen Ende des DDR-Regimes bemühte sich die Regierung um eine Verbesserung des Verhältnisses zum Staat Israel. Das kam auch der jüdischen Gemeinde Ost-Berlins zugute, denn zum 50. Jahrestag der Pogromnacht gestattete man die Gründung der Stiftung „Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum“ und veranstaltete am 10. 11. 1988 eine symbolische Grundsteinlegung zum Wiederaufbau der Fassade der Neuen Synagoge. Die Fertigstellung der Arbeiten fiel dann bereits in die Zeit nach der Wiedervereinigung. Am 7. 5. 1995 eröffnete das Centrum Judaicum mit der ständigen Ausstellung „Tuet auf die Pforten“. Das Gebäude enthält ferner ein Dokumentationszentrum mit Bibliothek, Vortragsräume, einen Repräsentantensaal, eine kleine Synagoge und ein rituelles Bad (Mikwe).
20 Romantisches Italien in Glienicke

Eine einzigartige Inszenierung von Italien als exotischem Land befindet sich im Schlosspark Glienicke. Hier entstand aus dem Herrenhaus eines Landguts von 1753 zunächst ein Schloss für den Staatskanzler Graf von Hardenberg und nach Erwerb des Geländes durch den Bruder Friedrich Wilhelms VI., Prinz Carl, ein Gesamtkunstwerk von europäischem Rang, gestaltet vom preußischen Staatsarchitekten Karl Friedrich Schinkel und dem königlichen Gartenbaudirektor Peter Joseph Lenné. Prinz Carl fasste nach seiner Italienreise 1822 den Entschluss, einen „Traum von Italien“ im heimatlichen Berlin zu verwirklichen, wobei in die bauliche Gestaltung dieses Traums sogar noch die Anreise nach Italien mit einbezogen wurde. Um das Konzept der Anlage in Glienicke nachvollziehen zu können, muss man sie von Norden her betreten, wo sich das neugotische Jägertor von Ludwig Persius befindet.

Es markiert den Beginn der Italienreise in Deutschland, wo die Gotik vorherrschend ist, nach damaliger Auffassung der typisch „deutsche Stil“. Nach dem Passieren des Tors wendet sich der Weg nach Süden und steigt auf die Höhe des Uferhangs zum Jungfernsee an. Der Anstieg symbolisiert die Alpenüberquerung, was durch die „Teufelsbrücke“ deutlich gemacht wird, eine Nachbildung der Brücke über die Reuss bei Andermatt auf dem Weg durch die Schweiz nach Italien. In den napoleonischen Kriegen schwer beschädigt, war das Schweizer Original zunächst unpassierbar und wurde später nur notdürftig repariert. 1820–30 errichtete man daneben eine neue steinerne Brücke, deren Bau der Berliner Landschaftsmaler Carl Blechen in seinem berühmten Ölgemälde „Bau der Teufelsbrücke“ (Neue Pinakothek, München) festgehalten hat. Auf diesem Gemälde basiert der Entwurf von Ludwig Persius für die Glienicker Teufelsbrücke, eine mit einem Brettersteg notdürftig geflickte dreibogige Steinbrücke, neben der sich ein gerader Holzsteg befindet. Die in Glienicke bereits vorher vorhandene Schlucht unter der Brücke wurde durch Aufschichten von Findlingsblöcken zu einer Felsenlandschaft ausgestaltet, mit einem Wasserfall als besonderer Attraktion. Zu Prinz Carls Zeiten wurde beim Nahen hochrangiger Parkbesucher das Wehr des oberhalb gelegenen Reservoir-Teichs geöffnet, so dass kurzzeitig beeindruckende, wenn nicht gar erschreckende, Wassermassen über die Felsen stürzten.


Dem romantischen Ensemble war ein kurioses Schicksal beschieden: Nach der Machtübernahme durch die Nazis sollte der Glienicker Park zum Volkspark umgewidmet werden. Dafür war ein Enteignungsverfahren und eine Entschädigungszahlung an die Hohenzollern als Besitzer des Geländes vonnöten. Um die Kosten möglichst niedrig zu halten, erstellte man ein Parkinventar mit vielen Hinweisen auf Wertminderung, wie z. B.: „Ruinöse Teufelsbrücke“. Nach der Enteignung begannen umfangreiche Umgestaltungen für die neue Bestimmung als Volkspark, was eine Begradigung des Wegesystems und die Auffüllung und Planierung des hügeligen Geländes durch Aushubmaterial vom Neubau der Königstraße zur Folge hatte. Während der Arbeiten stieß man auch auf den Hinweis auf die kaputte Brücke und „reparierte“ sie umgehend. Die romantische Idee einer mit gärtnerischen Mitteln dargestellten Italienreise ging durch diese Umbauten völlig verloren. (Und die Kosten für solch eine Vernichtung von Kulturgut holte sich das NS Regime auch noch durch die Beschlagnahme des Vermögens von Eugen Gutmann wieder herein, des jüdischen Bankiers aus der in Sichtweite von hier befindlichen Bertinistraße).
Die Wiedergewinnung des ursprünglichen Zustandes von Glienicke gestaltete sich nach dem Kriege als schwierig, da in Zeiten des Wiederaufbaus die Schaffung künstlicher Ruinen absurd erschien, auch wusste niemand mehr von der einstigen Schönheit des einmaligen romantischen Ensembles. Daran waren die Hohenzollern nicht ganz unschuldig, denn sie hielten das Kunstwerk Glienicke für die Allgemeinheit stets verschlossen, auch wenn sie es nach der Machtergreifung der Nazis selbst nicht mehr benutzten. Der Direktor der Preußischen Schlösser und Gärten, Martin Sperlich, war in den 1980er Jahren einer der Ersten, die den Wert und die Bedeutung von Schloss und Park Glienicke erkannten und sich um eine Rekonstruktion bemühten. Geldmittel, die während der Verschönerung der Stadt zur fiktiven 750-Jahr-Feier Berlins wieder reichlicher flossen, kamen auch der Restaurierung von Schloss und Park Glienicke zugute. Aber erst 2001 – 2006 konnte die Instandsetzung des Wasserfalls und der Rückbau der wiederaufgebauten Brücke durchgeführt werden. Allerdings wurde sie durch heftige Regenfälle im Jahre 2009 bereits wieder zur „echten“ Ruine. Notdürftig eingerüstet harrt sie seitdem der Restaurierung.

Steigt man von den „Alpen“ im Süden wieder hinunter, ist man in „Italien“ angelangt, einer lieblichen Landschaft voller Blumen (dem Pleasureground), einer Fülle pseudo-italienischer Bauten, Statuen und antiker Trümmer. Ein besonders romantisches Ensemble ist der nördlich des Schlosses gelegene Klosterhof. Er besteht aus einem Vorhof und dem schon zu Prinz Carls Zeiten verschlossenen kreuzgangartigen inneren Hof mit seinen mittelalterlichen Kunstwerken. Der Vorhof verweist durch eine hohe Säule mit dem Markuslöwen auf Venedig. Von dort stammen nämlich zahlreiche mittelalterliche Spolien, die im Klosterhof verbaut wurden.

In den heute leeren Nischen seitlich der großen Säule standen Ziersäulen. Ihre unteren Hälften (sandsteinerne Knotensäulen) stehen heute im Gartenhof, die Oberteile in Mosaik-Einlegearbeit befinden sich wegen der Gefahr von Vandalismus im Lapidarium. Bekannt ist das an einer Mauerecke eingebaute sog. Affenkapitell, das ein Kapitellfragment des Schiefen Turms von Pisa ist.


Die Arkaden des „Kreuzgangs“ werden von Doppelsäulen getragen, die auch das Eingangsportal flankieren. Sie stammen aus dem Kloster S. Andrea della Certosa bei Venedig, das beim Bau österreichischer Militäranlagen abgetragen wurde. Prinz Carl erwarb sämtliche Spolien über den Kunsthandel und schuf damit „die erste Sammlung byzantinischer Kunstwerke im modernen Europa.“ (Als „byzantinisch“ bezeichnete man damals auch die Kunst Venedigs und Unteritaliens). Der Klosterhof besteht aus einem U-förmigen, kreuzgratgewölbten Gang. Rechts an den Gang schließt sich eine Art Tresorraum an, der ursprünglich ein Oberlicht besaß und in dem sich sich eine überaus kostbare Sammlung mittelalterlicher Schatzkunst befand, darunter das heute im Kunstgewerbemuseum Berlin aufbewahrte goldene Vortragekreuz Heinrichs II. und der berühmte Goslarer Kaiserthron (heute in der Domvorhalle Goslar) aus dem 11. Jahrhundert. In den Wänden des Kreuzganges sind dekorative Reliefs der byzantinischen Kunst eingelassen. Es handelt sich überwiegend um Paterae und Formellae, also runde oder hochrechteckige, zumeist venezianische Zierreliefs.
Zu Zeiten Prinz Carls diente der Klosterhof als Frühstücksplatz. Man saß auf den Bänken in der Bogennische unter einem Spolien-Arrangement, das u. a. aus Teilen des Sarkophags des Philosophen Pietro d’Abano aus San Antonio in Padua, einer der berühmtesten Kirchen Italiens, besteht. Die mittelalterliche Brunnenmündung in der Mitte des Hofes wurde zum Springbrunnen umfunktioniert. Der Klosterhof ist eine ungewöhnliche Verbindung von romantischer Stimmungsarchitektur und Museum, gewissermaßen eine Eremitage mit Schaufenster.

Das Thema Italien in Glienicke setzt sich auch auf dem Areal des Schlosses fort: Die aus Italien mitgebrachten archäologischen Souvenirs des Prinzen sind in den Wänden des Innenhofs vermauert oder liegen malerisch im Park verstreut. Auch Bruchstücke pompejanischer Wandmalereien fanden den Weg nach Potsdam und befinden sich jetzt in der Loggia der „kleinen Neugierde“, einem an der Königstraße gelegenen Aussichtspavillon.


Die „große Neugierde“ im Stile eines Rundtempels (Monopteros) verweist obendrein auf Griechenland: Auf dem Dach platzierte Karl Friedrich Schinkel eine Replik des Lysikratesdenkmals in Athen, das dort für einen Theatermacher (Choregen) errichtet wurde. Auf der gegenüber liegenden Straßenseite der Königstraße befinden sich mit dem Ensemble Jagdschloss Klein-Glienicke und der Loggia Alexandra auf dem Böttcherberg weitere „italienische“ Gebäude.
Leider sind Schloss und Park Glienicke nach der spektakulären Präsentation zum Stadtjubiläum 1987, die ihm zwei Sternchen im Baedeker einbrachte, wieder der Vergessenheit anheimgefallen. Die politische Wende von 1989 und die deutsche Wiedervereinigung lenkten das Interesse auf die lange vernachlässigten Bau- und Gartendenkmale in Potsdam, für Glienicke dagegen wandte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten nicht einmal mehr die Mittel für die notwendige bauliche Unterhaltung auf. Deshalb verwundert es nicht, dass sich dieses Juwel 2021 in ausgesprochen schäbigem Outfit präsentiert: Verblasste und abblätternde Farben, faulende Fensterläden, verschlossene und zusätzlich weiträumig abgesperrte Bereiche und vor allem die heruntergekommenen Skulpturen aus Zinkguss, die, um ihr „steinernes“ Image zu bewahren, regelmäßig mit Farbe aufgefrischt werden müssen. Auch der Instandhaltungspflicht für den Park, die dem Gartenbauamt Zehlendorf obliegt, wird nicht nachgekommen: Anstatt die Bäume regelmäßig zu kontrollieren und entsprechende Pflegemaßnahmen durchzuführen, hat man mehrere hundert Meter lange, teure Absperrgitter angeschafft, die den Besuchern den Zugang versperren.
19 Die ganze Welt in Marzahn – Gärten der Welt
Durch die langjährige Teilung Berlins gab es viele Institutionen, die zu einer Metropole gehören, in Berlin gleich doppelt: Zoo, Oper (diese sogar dreifach!), Staatsbibliothek, Nationalgalerie und vieles andere mehr. Nachdem in West-Berlin 1985 die Bundesgartenschau veranstaltet und dafür der Britzer Garten angelegt worden war, ließ das die Verantwortlichen im Osten nicht ruhen, bis 1987, zum 750-jährigen Stadtjubiläum, der 21 Hektar große Erholungspark Marzahn als Berliner Gartenschau und Geschenk der DDR-Gärtner an die Hauptstadt verwirklicht werden konnte. Im Gegensatz zum Britzer Garten, der sein Konzept und Erscheinungsbild im Großen und Ganzen beibehalten hat, wurde der Erholungspark Marzahn nach der Wende zu etwas völlig Neuem. Innerhalb des weitläufigen Parkgeländes neben dem Kienberg enstanden schrittweise seit 1994 die „Gärten der Welt“, bisher neun verschiedene Themengärten, in denen die Gartenkultur verschiedener exotischer Länder präsentiert wird. Der Kienberg, ein eiszeitlicher Sandhügel, war nach dem Zweiten Weltkrieg durch Trümmeranschüttungen und eine Deponie für Erdaushub auf die für Berliner Verhältnisse stattliche Höhe von 102 m angewachsen. Als für 2017 eine internationale Gartenschau geplant wurde, beschloss man, die Marzahner Gärten dafür weiterzuentwickeln und den zwischen der U-Bahn und dem IGA-Gelände gelegenen Kienberg mit einer Seilbahn zu überqueren und als Erschließung der Ausstellung zu nutzen.

An der U-Bahnlinie nach Hönow steigt man am Bahnhof „Kienberg / Gärten der Welt“ aus und geht über die Straße zur Seilbahnstation „Kienbergpark“. Hier beginnt die 1,5 km lange Schwebestrecke, die zunächst auf den Gipfel des Kienbergs zum Wolkenhain führt, Aussichtsplattform und Kunstwerk zugleich. Von hier hat man einen fantastischen Ausblick auf das IGA-Gelände und überquert es bei der Weiterfahrt in beträchtlicher Höhe. Man landet in der Station „Gärten der Welt“, außerhalb der IGA, was zu der Forderung geführt hat, die Seilbahn als öffentliches Verkehrsmittel in Regie der BVG zu betreiben. Damit wäre sie langfristig in ihrem Betrieb gesichert, aber der Senat konnte sich bis jetzt noch nicht zu einer Entscheidung durchringen.

Der zuerst entstandene Chinesische Garten, der größte seiner Art in Europa, entstand infolge der 1994 geschlossenen Städtepartnerschaft Berlin – Beijing. Das chinesische Institut für klassische Gartenarchitektur entwarf den „Garten des wiedergewonnenen Mondes“; errichtet wurde er mit chinesischen Baumaterialien von Handwerkern aus Beijing. In 100 Seecontainern brachten sie alle kostbaren Hölzer, Steine, Felsen, Skulpturen und Möbel für den Garten aus China nach Berlin. Sie bezogen sich zwar auf die Idee des klassischen chinesischen Gelehrtengartens, schufen aber dennoch etwas Neues, das die Form und Gestalt der Jahrtausende alten chinesischen Gartenkunst zitiert: Einen schlichten Garten in dezenter Farbgebung (grau, weiß und rot), dessen Zentrum ein 4.500 Quadratmeter großer, in eine bepflanzte Hügellandschaft eingebetteter See darstellt. Verschiedene Gebäude, Brücken und Platzflächen umgeben ihn, von denen das über eine Zickzackbrücke zu erreichende Teehaus „Berghaus zum Osmanthussaft“ das bedeutendste ist. Seit Jahrtausenden gehören fantastisch geformte Felsen und Steine zu den Besonderheiten eines Chinesischen Gartens, deshalb wurden sie auch hier aufgestellt. Eines der dabei verwendeten Mottos ist: „Der Stein muss mager sein und faltig wie ein Hundertjähriger“.


Auch der japanische „Garten des zusammenfließenden Wassers“ ist das Ergebnis einer Städtepartnerschaft von 1994, in diesem Fall mit Tokyo. Shunmyo Masuno – Gartendesigner, Professor und Zen-Priester aus Tokyo – schuf von 2001 – 2003 den Japanischen Garten mit seinen traditionellen Stilelementen: Eine in sich geschlossene Gartenwelt mit Pavillon, Teich, Wasserläufen, Trockengarten und imposanten Steinsetzungen. Der japanische Garten soll eine Stätte der Ruhe, des Nachdenkens und der Besinnlichkeit inmitten der geschäftigen Großstadt sein. Typische japanische Pflanzen, wie Fächerahorn, Japanische Blumenhartriegel, Japanische Lavendelheide und viele Zierkirschen finden sich hier. Die drei Teile des Gartens symbolisieren Geschichte, Gegenwart und Zukunft, das Wasser ist das verbindende Leitmotiv: Eine Quelle in Gestalt eines Wasserfalls, die als Bach durch den Rasen fließt, symbolisiert den Lauf der Geschichte, der Bach mündet in einen kleinen Teich, der die Gegenwart widerspiegelt. Vom daneben befindlichen Pavillon blickt man auf einen Steingarten, der als Zen-Meditationsgarten angelegt ist und für die Zukunft steht.

Der sich seit dem 18. Dezember 2003 in einem Gewächshaus präsentierende Balinesische Garten, genannt „Garten der drei Harmonien“, ist wie eine traditionelle balinesischen Wohnanlage mit Garten aufgebaut. Eine Lehmziegelmauer grenzt die Wohnanlage von der Umgebung ab. Die Besucher betreten diesen „privaten“ Bereich durch ein Tor mit Namen Ankul angkul, das die in Thailand allgegenwärtige Dreiteilung (die auch im Namen des Gartens auftaucht) aufweist, den Sockel mit den Stufen (= Fuß), die Tür aus Teakholz (= Körper) und das mächtige Dach mit Krone (= Kopf). Auch der Haus- oder Familientempel (Sanggah) besteht aus drei Schreinen. Das größte Gebäude der Wohnanlage, der Bale Dangin genannte überdachte Pavillon, dient den unterschiedlichen Beschäftigungen der Hausbewohner. Im Garten befindet sich ein tropischer Urwald mit Pflanzen, die wir häufig als Zimmerpflanzen verwenden, Baumfarne, viele unterschiedliche kleinere Farne, Blattpflanzen und Blütenpflanzen und vor allem eine große Anzahl verschiedener Orchideen-Arten. Unverzichtbarer Bestandteil eines Balinesischen Gartens ist jedoch der heilige Frangipani-Baum – auch Tempel- oder Pagodenbaum genannt.

2005 kam der Orientalische Garten zum Ensemble der Gärten der Welt hinzu. Kamel Louafi, ein aus Algerien stammender Berliner Garten- und Landschaftsarchitekt, der Gartenhistoriker Mohammed El Fai’z aus Marrakesch und eine Gruppe marokkanischer Handwerker haben das Kleinod geschaffen, das die Gartentradition verschiedener islamischer Länder zeigt. Der „Garten der vier Ströme” ist von einer vier Meter hohen Mauer umgeben, innerhalb derer sich der orientalischen Vorbildern entsprechende geometrisch-vierteilige Gartenhof (Riyad) erstreckt. Das Anlegen eines Gartens bedeutet nach orientalischer Tradition die Schaffung einer künstlichen Oase oder des Paradieses. Dem Paradiesgarten des Korans mit seinen Bächen aus Wasser, Milch, Wein und Honig entsprechen hier die vier, durch Wasserspiele belebten, unter dem mittleren Pavillon aus einer Brunnenschale hervorströmenden Flüsse. Im Sommer 2007 wurde dem Garten der vier Ströme noch der Saal der Empfänge hinzugefügt. Es ist ein leerer, von einer Glaskuppel erhellter Raum, umgeben von Arkaden auf 28 Säulen mit fein geschnitzten, duftenden Zedernholzbögen. Dieser Saal fungiert jetzt als Eingangshalle in den bezaubernden Gartenhof.
Am 31. März 2006 öffnete der fünfte „Garten der Welt“: der koreanische „Seouler Garten“. Als Geschenk der Stadt Seoul an Berlin ist er ein authentisches Beispiel koreanischer Gartenkultur. Wie bei den anderen Marzahner Gärten stammt die Gartenplanung aus dem Ursprungsland; eigens aus Seoul angereiste koreanische Handwerker bauten den Garten im Jahr 2005 auf: eine abwechslungsreich gestaltete naturnahe Landschaft mit einem Pavillon, vier aufeinander folgenden, von Mauern eingefassten Höfen mit unterschiedlich gestalteten Toren sowie Skulpturen. Alles folgt der traditionellen koreanischen Gartenkultur. Drei unterschiedliche Bereiche kennzeichnen die Anlage: freie Räume oder Höfe, die als »Ma-Dang« bezeichnet werden, Pavillons und die Landschaft. Kiefern, Bambus, Eichen und Fächerahorn sind einige der verwendeten Baumarten. Am Rande des höchsten Ma-Dangs steht ein großer Pavillon, der „Pavillon am Wasser“.

Von 2007 bis 2011 wurde vier weitere Gärten hinzugefügt, die sich aber auf europäische Regionen beziehen. Zunächst Irrgarten und Labyrinth wobei sich ersteres auf England bezieht (nach dem Vorbild des Irrgartens von Hampton Court Palace aus dem 17. Jahrhundert) und letzteres auf Frankreich (nach einem als Intarsie in den Boden eingelegten Bodenlabyrinth der Kathedrale von Chartres aus dem 13. Jh.). Die deutsche Gartenkunst wird durch einen Karl-Foerster-Staudengarten repräsentiert, inspiriert vom 1912 entstandenen Karl-Foerster-Garten in Bornim bei Potsdam.


Ein reizvoller Ort, um sich nach Italien zu versetzen, ist der Italienische Renaissancegarten. Sein Name „Giardino della Bobolina“ bezieht sich einerseits auf die Boboli-Gärten in Florenz, andererseits auf die darin aufgestellte Venus „della Grotticella“ von Giambologna (1529 – 1608), die von den Florentinern zärtlich „Bobolina“ genannt wird. Der einmalige Zauber der berühmten toskanischen Villengärten mit steinernen Brunnen, Terrakotten, antiken Skulpturen, Eiben- und Buchsbaumhecken, Orangenbäumchen und Rosen, Stauden und Rasenflächen soll hier in Marzahn beschworen werden. Die Anlage teilt sich in Vorplatz mit Terrasse, Hauptgarten und giardino segreto. Vom Vorplatz gelangt man durch ein 2-flügliges Holztor auf die Terrasse, auf der in großen Terrakottakübeln mediterrane Pflanzen stehen, von hier kommt man durch ein großes schmiedeeisernes Tor in den Hauptteil, den Giardino della Bobolina. Er bildet ein großes, von hohen geschnittenen Eibenhecken umstandenes Karree mit gepflasterten Wegen, in dessen Mitte ein Brunnen und eine Fontäne angelegt sind. Verschiedene Renaissancearchitekturen (Loggia, Portale, Wandbrunnen) und kleine von geschnittenen niedrigen Buchsbaumhecken eigefasste Rasenflächen, auf denen zahlreiche Zitronenbäumchen stehen, charakterisieren ihn. In der Nische einer Loggia steht die Replik der oben erwähnten „Bobolina“. Das tiefer gelegene Parterre bildet den nächsten Gartenteil, den „Giardino segreto“ (Privatgarten). Über eine schmale Natursteintreppe gelangt man vom „Giardino della Bobolina“ hinab. Hier gibt es Kieswege, die ein typisches Motiv italienischer Renaissancegärten sind und das private Ambiente dieses Gartenteils betonen. Die Nische im Giardino segreto wurde als Wandbrunnen aus Tuffsteinen mit eingelassenen Wasserdüsen erbaut und bildet auf diese Weise die „Grotte“, ein typisches Gestaltungselement des Italienischen Gartens.
Der zuletzt (2011) entstandene Christliche Garten, die Nachbildung eines mittelalterlichen Klostergartens in Form eines Kreuzgangs, erzeugte zunächst Streit ob seiner Namensgebung. Ursprünglich sollte keiner der Gärten nach einer Religion benannt werden (was bei den anderen Gärten, die sich ja ebenfalls auf Religionen beziehen, auch eingehalten wurde). In Falle des christlichen Gartens behielt man jedoch den anfangs nur als „Arbeitstitel“ genutzten Namen bei. Laut der Verwaltung für Stadtentwicklung seien Alternativen gründlich geprüft worden, doch keine sei dem Konzept gerecht worden. Somit werde die gegenwärtige Namensgebung nicht mehr in Frage gestellt.
20 Die ganze Welt in Potsdam I
Die Residenzstadt Potsdam vor den Toren Berlins ist geradezu ein Musterbeispiel für die Verlegung exotischer Orte in die Heimat. Seit fast 300 Jahren haben sich Herrscher, Adlige und wohlhabende Bürger ihre Träume von der Ferne architektonisch hier verwirklicht. Mit dem Fahrrad oder in zwei Expeditionen zu Fuß kann man fast die ganze Welt in Potsdam erkunden.

Der Rundgang 1 beginnt am Alten Markt in Potsdam, wo das im Krieg beschädigte und 1960 abgerissene ehemalige Stadtschloss als Landtagsgebäude wieder aufgebaut ist. Auf der Mitte des Platzes steht der 1753 bis 1755 im Zusammenhang mit der repräsentativen Umgestaltung der Stadt errichtete Obelisk. Die Pläne dafür stammen vom Architekten Friedrichs II., Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff. Ihm schwebte sicherlich weniger Ägypten als Rom vor Augen, wo die Päpste die von den alten Römern in die ewige Stadt verbrachten Obelisken aus den antiken Trümmern ausgraben und zur Unterstreichung ihrer Macht wieder aufstellen ließen.

Darauf deutet auch die übrige Gestaltung des Potsdamer Obelisken hin: Die antiken Rednerfiguren an den Ecken (von Heymüller) und die vier Medaillons an den Seiten (von Giese). Sie stellten ursprünglich vier Hohenzollernherrscher dar: Friedrich Wilhelm, den Großen Kurfürsten und die preußischen Könige Friedrich I., Friedrich Wilhelm I. sowie Friedrich II. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Königsmedaillons aus politischen Gründen entfernt und durch Bildnisse der Baumeister Knobelsdorff, Gontard, Schinkel und Persius ersetzt. 1969 baute man den Schaft des Obelisken wegen Baufälligkeit ab und erst zehn Jahre später wieder auf. Beim Wiederaufbau war der vorher für die Medaillons und Dekorationen benutzte weiße Carrara-Marmor aus Italien zu teuer, deshalb verwendete man Ersatz aus Jugoslawien. Der rote schlesische Marmor des Schafts wurde durch russischen ersetzt.

Der Potsdamer Alte Markt galt bis 1945 als einer der schönsten Plätze Deutschlands. Das lag daran, dass Friedrich dem Großen daran gelegen war, seine Residenzstadt den anderen europäischen Metropolen vergleichbar zu machen. So wies er seine Architekten an, für die markanten Gebäude Potsdams Entwürfe renommierter italienischer Architekten, allen voran Andrea Palladio zu verwenden. Am Alten Markt versammelte sich dadurch ein harmonisches Ensemble aufeinander abgestimmter Bauten. In der Bombennacht 1945, kurz vor Ende des Krieges, ging das meiste davon unter, nur das Rathaus und das Knobelsdorff-Haus (beide nach Entwurf von Palladio), sowie der Obelisk in der Platzmitte blieben erhalten. Doch mittlerweile sind nach Fertigstellung der Schlossfassade auch die übrigen Gebäude wieder aufgebaut, wie die Palazzi Barberini, Pompei und Chiericati, die Potsdam das Ambiente einer italienischen Stadt verleihen. Im Palazzo Barberini residiert mittlerweile ein privates Museum, das es mit seinen hochkarätigen Ausstellungen durchaus mit dem Römischen Nationalmuseum im dortigen Palazzo Barberini aufnehmen kann.

Durch die Breite Straße bewegt man sich nun nach Westen, zum ehemaligen Neustädter Tor, das ursprünglich durch zwei Obelisken (ebenfalls von Knobelsdorff) markiert war, von denen aber durch die Kriegseinwirkungen nur noch einer erhalten ist. Dieser Obelisk von 1753 kommt schon deutlich ägyptischer daher, mit Hieroglypheninschriften auf dem Schaft. Diese Hieroglyphen waren allerdings den ägyptischen nur nachempfunden und ergeben keinen Sinn, schließlich erfolgte die Entzifferung der Hieroglyphen erst 1822 durch Champollion. Bekrönt waren die Obelisken jeweils mit einem preußischen Adler. Zu beiden Seiten gab es je ein Häuschen für die Wachmannschaft und den Zoll. Davon ist nichts geblieben.

Inmitten der sozialistischen Bebauung, die auf dem – wegen der Verlängerung der Breiten Straße – zugeschütteten Teil der Neustädter Havelbucht steht, erhebt sich, gleich in mehrfacher Hinsicht als Fremdkörper, das Dampfmaschinenhaus von Sanssouci. Es ist im Stil einer maurischen Moschee gehalten und beherbergt die Dampfmaschine, die seit 1842 das Wasser von der Neustädter Havelbucht in das Reservoir auf dem Ruinenberg pumpt. Das „Minarett“ ist nur die Camouflage des Schornsteins. Die Originalmaschine von August Borsig ist noch erhalten und wird bei der Führung jeden Sonnabend durch einen Elektromotor bewegt, während die eigentliche Pumparbeit durch eine wesentlich kleinere, aber leistungsfähigere Elektroturbine erledigt wird. Architekt des exotischen Bauwerks war der „Architekt des Königs“, Ludwig Persius, der sich beim Äußeren von Formen „maurischer“ Architektur und beim Inneren von der Moschee in Cordoba inspirieren ließ.

Von der Moschee geht man nun die Breite Straße bis zum Ende, überquert die Zeppelinstraße und geht in gleicher Richtung die Feuerbachstraße entlang. Man biegt in die erste Querstraße, die Sellostraße rechts ein bis zur Lennéstraße. Nach ein paar Schritten links findet man einen verborgenen Eingang nach Sanssouci, den Affengang. (Der seltsame Name rührt von dem Affen her, den der spleenige Lord Marschall Keith, ein Schotte in Diensten Friedrichs des Großen, neben seinem Palais spazieren führte). Diesen geht man bis zur Allee nach Sanssouci und diese weiter in Richtung Hauptallee mit der Großen Fontäne. Blickt man nach rechts, sieht man am Ende der Allee den Obelisken, der als Eingangsmarkierung nach Sanssouci dient. Er ist dem Obelisken am Neustädter Tor sehr ähnlich, ebenfalls mit nicht lesbaren Hieroglyphen und stammt auch von Knobelsdorff (1748).


Wir wenden uns nach links in die Hauptallee, wo wir nach drei Querwegen wieder links zum Chinesischen Haus einbiegen. Dieser auch Chinesisches Teehaus genannte Pavillon wurde nach Zeichnungen Friedrichs des Großen vom Architekten Johann Gottfried Büring in den Jahre von 1756 – 1764 errichtet. Die lange Bauzeit ist auf den Siebenjährigen Krieg zurückzuführen, in dem sich Preußen gegen die europäischen Großmächte behaupten musste und während dessen königliche Lusthäuser nicht ganz oben auf der Agenda standen. Der Gartenpavillon ist im Stil der Chinoiserie gehalten, die zur Zeit des Rokoko ungemein populär war. Die Chinoiserie vereinigte Stilelemente des Rokoko mit ostasiatischen, die über Handelswaren der zu dieser Zeit aufblühenden Ostindischen Kompanie nach Europa kamen: Bemalte Lackkästchen, Porzellandekor und ostasiatische Aquarellbilder vermittelten die Motive an die europäischen Künstler, die fast ausnahmslos China niemals in ihrem Leben gesehen hatten. Das ist auch am Potsdamer Pavillon festzustellen, wo die „Chinesinnen“ Rokokogewänder tragen und die Musikerstatuen fantasievolle Instrumente spielen, die mit fernöstlichen nichts zu tun haben. (Auch ein „Saxophon“ ist dabei, obwohl es doch erst 100 Jahre später erfunden wurde!). Im Teehäuschen wurden kleinere Feste gegeben, für die man unweit noch eine Chinesische Küche errichtete. Nach einem Umbau 1789 hat dieses Gebäude seine exotischen Formen verloren, nur noch die sechseckigen Fenster erinnern an den einstigen Dekor.

Setzen wir unseren Weg in südwestlicher Richtung fort, gelangen wir zu den Römischen Bädern, einem bezaubernden Ensemble, in dem die römische Antike beschworen wird. Sie gehören zum Charlottenhof (benannt nach einer früheren Besitzerin) wo Friedrich Wilhelm IV. seit seiner Kronprinzenzeit ein Sommerschloss besaß. Schloss und Bäder wurden nach Zeichnungen des künstlerisch begabten Kronprinzen – politisch war er das weit weniger – durch den preußischen Staatsbaumeister Karl Friedrich Schinkel errichtet, die Bauleitung oblag seinem späteren Nachfolger Ludwig Persius. Das 1834 – 1840 errichtete, turmgekrönte Bauwerk gehört zu einer ungemein malerischen Gebäudegruppe, bestehend aus dem Bad, das niemals als solches diente, dem Teepavillon im Stile eines Tempels und dem Gärtnerhaus, das Ganze verbunden mit Arkaden, Pergolen und Heckenpflanzungen. Es ist ein reines Produkt der Romantik, das römische Bauelemente wie Thermen, Villa, Tempel und Atrium relativ zweckfrei miteinander kombiniert.


Wir wenden uns jetzt wieder nördlich zur Hauptallee, queren diese, verlassen das umzäunte Parkgelände und gelangen so zur Maulbeerallee, die wir in Richtung Westen entlang gehen. Auf dem Gelände des Botanischen Gartens – gegenüber den Gewächshäusern – finden wir das bezauberndste Stück Italien, das Potsdam zu bieten hat, das Paradiesgärtlein, ab 1841 unter Friedrich Wilhelm IV. als umfriedeter Nutzgarten angelegt, in dem sich ein Atrium (von Ludwig Persius nach Vorgaben des Königs entworfen), eine Pergola entlang der Mauer zur Maulbeerallee und eine 1846 von Ludwig Ferdinand Hesse gestaltete Wassertreppe befinden.



Unweit westlich davon liegt der Aufstieg zum Drachenhaus, wo wir uns schon wieder im Reich der Chinoiserie befinden. Es wurde 1770 – 1772 von Carl von Gontard als Wohnhaus für den Winzer des hier befindlichen Weinbergs errichtet. Es greift den Stil der chinesischen Pagode auf und an seinem Beispiel können wir die Wege des chinesischen Stils nach Europa verfolgen: Der britische Architekt William Chambers studierte die Bau- und Gartenkunst Chinas während mehrerer Aufenthalte im Dienst der Schwedischen Ostindien-Compagnie vor Ort. Dort sah und zeichnete er die Ta-Ho-Pagode in der Nähe der südchinesischen Stadt Kanton. 1749 ging er zum Architekturstudium nach Paris. Danach betrieb er eines der großen Architekturbüros in London und erhielt den Auftrag für die Anlage der Royal Botanical Gardens in Kew. Die Zeichnung seiner Pagode setzte er baulich in einen Gartenpavillon im Stil der Chinoiserie um. Über sein im Besitz Friedrichs des Großen befindliches Werk: „Designs of Chinese buildigs“ gelangte der Entwurf nach Preußen, wo er auf Anweisung des Königs von Gontard kopiert wurde.
Wir verbleiben auf der Anhöhe, wenden uns aber wieder zurück nach Osten und erreichen das nach Skizzen Friedrich Wilhelms IV. von August Stüler und Ferdinand Hesse erbaute Orangerieschloss, das ein Stück Italien darstellt, eine Kopie der Villa Medici in Rom. Zur Verstärkung des Italiengefühls befindet sich im Innern ein prachtvoller (Pseudo-)Barocksaal mit Kopien von Gemälden Raffaels. Das Gebäude selbst ist eine Kombination von Orangerie und Schloss, wobei die Erdgeschossräume für die Aufnahme der Pflanzen dienen und die oberen Geschosse für Wohnzwecke ausgebaut wurden.

Es geht auf der Höhenstraße weiter in Richtung Osten, bis wir Schloss Sanssouci erreichen. In seinem Innern birgt es – wie auch das Neue Palais am anderen Ende des Parks Sanssouci – ein Chinesisches Zimmer. Zur weiteren Ausstattung gehören antike Statuen, italienische und französische Gemälde. Der Parkbereich im Umfeld des Schlosses ist im Stil des Schöpfers des französischen Barockgartens, des Gartenarchitekten von Versailles, Le Nôtre, gestaltet.
Vom Kolonnadenhof auf der Nordseite erblickt man den Ruinenberg. Auf seinem Gipfel wurde das Wasserreservoir zum Betreiben der Großen Fontäne unterhalb von Sanssouci angelegt. Zu Friedrichs Zeiten funktionierte der Wassertransport auf den Berg jedoch nicht, weil die Holzröhren der damaligen Zeit dem Wasserdruck nicht stand hielten und die durch Windmühlen angetriebenen Pumpen es nicht schafften, eine hinreichende Wassermenge nach oben zu transportieren. Für die Einweihung der Fontäne mussten Bauern im Winter davor mit Pferdefuhrwerken Schnee nach oben bringen, der dann, geschmolzen, nur eine zu vernachlässigende Menge Wasser ergab. Am Eröffnungstag, Karfreitag 1754, sprudelte die Fontäne nur wenige Minuten und erreichte gerade einmal eine Höhe von 1,5 m. Der König war so erzürnt, dass die Fontäne zu seinen Lebzeiten nie wieder angestellt wurde. Erst unter Friedrich Wilhelm III. wurde durch die Anschaffung einer Dampfmaschine und die Errichtung des Dampfmaschinenhauses (Moschee, s.o.) das Problem gelöst.

Friedrichs Architekt Knobelsdorff erhielt den Auftrag, den Gipfel des Ruinenberges mit einem Ensemble künstlicher Ruinen zu verschönern, die das antike Rom beschwören sollten. Nach Überarbeitung des Knobelsdorff-Entwurfs durch den königlichen Theaterarchitekten und Bühnenbildner (!) Innocente Bellavita errichtete man die an die Außenwand des Kolosseums erinnernde Theaterwand, die drei dem Castor-und-Pollux-Tempel auf dem Forum Romanum nachempfundenen Säulen, einen griechischen Monopteros mit (künstlich) eingestürzter Kuppel und eine an den Castortempel angelehnte, zerbrochene Säule, die den Anschein erwecken sollte, als habe sie beim Umstürzen wie durch Zufall Halt gefunden. Der nicht zur römischen Antike passende „Normannische Turm“ entstand erst unter Friedrich Wilhelm IV.

Man steigt nun die Weinbergterrassen von Sanssouci hinunter, passiert die Große Fontäne und geht zuerst geradeaus, dann links die Allee nach Sanssouci zum Ausgang. Dort, Am Grünen Gitter, befindet sich ein weiteres bezauberndes Ensemble, das die Italiensehnsucht Friedrich Wilhems IV. befriedigen sollte: die Friedenskirche mit Klosterhof und Mausoleum. 1834 konnte auf dem Kunstmarkt das Apsismosaik der romanisch-byzantinischen Kirche S. Cipriano, die einst auf der Insel Murano bei Venedig stand, erworben werde. Die Kirche war wegen Baufälligkeit abgerissen worden und ein gewitzter Kunsthändler hatte das Mosaik ausgebaut und in den Handel gebracht. (Der ansonsten so konservative Friedrich Wilhelm, der es ankaufte, gehörte in diesem Fall einmal zur Avantgarde, denn damals interessierte sich noch kaum jemand für romanische und byzantinische Kunst). Der frömmlerische König suchte nach den ihn so verstörenden Ereignissen der 1848er Revolution nach einem Symbol, das die wieder herzustellende Einheit von Religion, Monarchie und Volk repräsentieren sollte. Das hoffte er in Gestalt der Friedenskirche zu finden, die durch ihre Architektur – und besonders das Mosaik – die frühchristliche Frömmigkeit, durch die königliche Grablege die Monarchie und durch den Gemeindesaal das Volk vereinen sollte.

Die Friedenskirche wurde gewissermaßen um das Mosaik herum gebaut: es bestimmte durch seine Größe die Ausmaße und durch seine Entstehungszeit (um 1200) den Stil der Kirche. Friedrich Wilhelm, der in seinem Leben zwei Mal in Rom gewesen war, ließ sie nach dem Vorbild von San Clemente errichten, wobei das Apsismosaik, der Chorbereich mit Ambo (Lesepult), Osterleuchter und Ziborium (Baldachin über dem Altar) sowie das Peristyl vor der Kirche die wichtigsten übernommenen Elemente darstellten. Aber auch das querschifflose Langhaus und die mit antikisierenden Kapitellen versehenen Säulen erwecken den Eindruck einer echten altrömischen Basilika. In der Krypta unter dem Chor (die es in San Clemente nicht gibt) ließ der König die Gräber für sich und seine Gemahlin anlegen.
21 Die ganze Welt in Potsdam II

Für den zweiten Rundgang in Potsdam zu den exotischen Orten verwendet man am besten das Fahrrad. Ein guter Startpunkt wäre die Glienicker Brücke, wo man am Wasser die Schwanenallee entlang fahren kann. Gleich am Anfang liegt die von Ludwig Persius entworfene Villa Schöningen im Stil florentinischer Turmvillen. Nach wenigen Metern erreicht man Kongsnæs (norwegisch für: Landzunge des Königs). Kaiser Wilhelm II., ein großer Norwegen-Liebhaber, besuchte das Land von 1889 bis 1914 alljährlich an Bord der SMY (Seiner Majestät Yacht) „Hohenzollern“. 1892 ließ er sich am Jungfernsee sein eigenes Stück Norwegen, eine Matrosenstation im nordischen Stil, errichten. Das Ensemble bestand aus einem geschnitzten hölzernen Torbogen als Eingang, dem Empfangsgebäude, einem Bootshaus für das kaiserliche Dampfschiff „Alexandra“ und drei Blockhäusern, die als Matrosenunterkunft, Wohnhaus des Stationsleiters und Werkstatt dienten. Der norwegische Architekt Holm Hansen Munthe, Schöpfer des nordischen Nationalstils (Drachenstil) erhielt im Jahr 1892 den Auftrag für das reich verzierte Empfangsgebäude, die eigentliche Attraktion der Anlage. Nach Abdankung des Kaisers wurden die Gebäude vermietet. In den Jahren von 1922 bis 1940 nutzte der kaiserliche Jachtklub das Empfangsgebäude als Klubhaus. Bootshaus und Empfangsgebäude gerieten im Jahr 1945 – am Ende des Zweiten Weltkrieges – in Brand und wurden dabei zerstört, über den Grundmauern entstanden nach 1961 die Grenzbefestigungsanlagen.

Die drei norwegischen Blockhäuser sind bis heute im Original erhalten geblieben und dienten nach dem Krieg als Wohnhäuser. Vom Empfangsgebäude waren nur noch die Fundamente zu sehen. Nach der Wende setzte sich ein Förderverein für den Wiederaufbau von Kongsnæs ein. Er veranlasste auch den originalgetreuen Nachbau des Eingangstores und die Restaurierung des Bollwerks. Das neue Empfangsgebäude sollte zeitgleich mit seinem Zwillingsbau in Oslo – der im Jahr 1936 abgebrannt war – mit norwegischer Hilfe wieder aufgebaut werden und die Miniaturfregatte „Royal Louise“ hier ihren neuen Heimathafen bekommen.

2009 wurde das Areal jedoch für rund eine Million Euro von dem Investor Michael Linckersdorff erworben, der die große Halle original aufbauen und darin ein Café-Restaurant mit 60 Plätzen innen und 30 auf der Veranda betreiben wollte. Auch die Norwegischen Häuser sollten denkmalgerecht saniert und anschließend als „Seglerheim“ mit maritimem Schaudepot sowie zum Wohnen eingerichtet werden. Geplant waren zudem ein 30 Meter langer Steg im Jungfernsee und 30 Liegeplätze für historische Boote. Über die Ausmaße des Projekts und sein Störpotenzial für die (betuchten) Anlieger der Schwanenallee stritten sich diese mit dem Investor erbittert und legten zwischendurch sogar das ganze Projekt auf Eis. Nach langem Gezerre konnte endlich die so genannte Ventehalle im norwegischen Drachen-Stil (und somit das Restaurant) fertig gestellt und eingeweiht werden, während sich die drei norwegischen Blockhäuser noch im Stand der Restaurierung befinden. Allerdings sorgte die Corona-Pandemie schon bald für eine erneute Schließung von Kongsnæs.
Weiter geht es die Schwanenallee entlang zur Schwanenbrücke über den Hasengraben, der den Heiligen See mit dem Jungfernsee verbindet. Hier beginnt der Neue Garten. Bereits in seiner Kronprinzenzeit von Friedrich Wilhelm II. erworben, sollte das Gelände dem Zeitgeist entsprechend gartenarchitektonisch modern gestaltet werden und sich vom barocken Park Sanssouci – und somit auch von Friedrich dem Großen – abheben, daher der Name. Im Neuen Garten finden wir mehrere, reizvoll inszenierte, exotische Orte. Dazu biegen wir am grünen Haus links ab und begeben uns Richtung Marmorpalais.

Der Eiskeller 1791/92 als Pyramide (allerdings auf einem kubischen Unterbau) nördlich in der Sichtachse des Marmorpalais errichtet, diente zum Frischhalten der Lebensmittel, die im Marmorpalais verbraucht wurden. Im Winter sägte man aus dem nahen Heiligen See Eisblöcke heraus und stapelte sie in der untersten Etage des circa 5 Meter in den Boden gehenden Kellers auf isolierenden Strohschüttungen. Auf diese Weise konnten sie sich bis in den Herst hinein halten und die Kühlung des Raumes sicherstellen.

Neben dem Marmorpalais, dem 1787 – 1792 von Carl von Gontard errichteten Sommerschloss Friedrich Wilhelms II. (links, wenn man mit dem Rücken zum Heiligen See steht) steht separat das Küchengebäude. Es wurde 1788 – 1790 von Carl Gotthard Langhans, dem Erbauer des Brandenburger Tores in Berlin, im Stile einer versunkenen römischen Tempelruine erbaut. Damit die Speisen auf dem Weg zum Schloss nicht kalt wurden, fügte Langhans einen unterirdischen Verbindungsgang zwischen beiden Gebäuden hinzu.

Unweit südwestlich der Küche befindet sich die Orangerie des Neuen Gartens. Sie ist ein besonders reizvoller, durch die Mischung unterschiedlicher Baustile exotisch wirkender Ort. An den beiden Kopfseiten des Gebäudes liegen die Pflanzenhallen für die Überwinterung der exotischen Pflanzen, in der Mitte dazwischen der holzgetäfelte Palmensaal. Hier fanden öffentliche Konzerte statt, bei denen der musisch begabte König selbst das Violoncello spielte. Das ägyptische Portal an der Ostseite wird von einer auf dem Architrav liegenden Sphinx bewacht, in zwei Wandnischen des halbrunden Eingangsbereichs stehen zwei schwarz gefärbte Statuen ägyptischer Götter aus der Werkstatt des Bildhauers Johann Gottfried Schadow. Die Halbkuppel des Raumes ist mit römischen Kassetten dekoriert.
Am Südende des Neuen Gartens steht die Gotische Bibliothek, ein kleiner, zweistöckiger Pavillon für die Büchersammlung Friedrich Wilhelms II. Neben den üblichen französischen Werken befand sich hier auch deutsche Literatur. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Friedrich dem Großen, der nur Französisches bevorzugte, förderte Friedrich Wilhelm II. die deutsche Kunst. An preußischen Theatern wurden während seiner Herrschaft nun auch Stücke von Schiller und Lessing aufgeführt.

Von der Gotischen Bibliothek geht der Weg wieder nach Norden zum Haupteingang des Neuen Gartens, dann außerhalb des Parks die Straße am Neuen Garten wenige Meter nördlich entlang, bis man zum Mirbach-Wäldchen gelangt, einer Grünanlage, die den Neuen Garten und den Pfingstberg verbindet. Hier wendet man sich nach links und steigt zum Pfingstberg hinauf.

Diese 76 m hohe Erhebung trug ursprünglich den Namen Eichberg; nach 1743, nach der Anlage des jüdischen Friedhofs erfolgte die Umbenennung in Judenberg und 1817, nachdem das Gelände in königlichen Besitz übergegangen war, in Pfingstberg. (Ein Besuch Friedrich Wilhelms III. mit Königin Luise zu Pfingsten 1804 soll Ursprung des Namens sein). Den Bau des romantischen, ganz der Italiensehnsucht verhafteten Belvederes auf dem Pfingstberg veranlasste aber erst Friedrich Wilhelm IV. Ursprünglich sollte hier ein ganzes Pfingstbergschloss entstehen, nach dem Tod des Königs 1861 wurde aber durch Hesse und Stüler nur eine „abgespeckte“ Variante verwirklicht. Von hier hat man einen fantastischen Blick auf die Potsdamer Landschaft und zur Steigerung der Annehmlichkeiten eines Besuchs ließ Friedrich Wilhelm IV. in die beiden Türme jeweils ein exotisches Kabinett einbauen: das römische und das maurische Kabinett, in denen sich die königliche Gesellschaft zum Teetrinken niederlassen konnte. Insbesondere das maurische Kabinett erstrahlt jetzt nach der Renovierung wieder im goldenen Glanz seiner Mosaike und arabischen Ornamente.

Nach dem zweiten Weltkrieg und dem Niedergehen des Eisernen Vorhangs befand sich das Belvedere auf dem Pfingstberg plötzlich im Grenzgebiet zwischen den Systemen. Das Besteigen der Türme war – insbesondere nach dem Bau der Mauer – nicht mehr erlaubt, man hätte ja ach so wichtige militärische Geheimnisse auspähen können! So wurde das Kunstdenkmal der Vernachlässigung anheim gegeben, die Nähe einer russischen Kaserne tat ein Übriges. Die Soldaten trafen sich in ihrer Freizeit gern in dem immer mehr zur Ruine verkommenden Gebäude zu Zechgelagen. Mehrfach kam es zu Bränden, die die Dächer der beiden Seitenflügel vernichteten. Die an der Erhaltung des Pfingstbergensembles völlig uninteressierte Stadtverwaltung entledigte sich schließlich ihrer Verantwortung, indem sie das Denkmal einfach nicht mehr in die Karte der Potsdamer Sehenswürdigkeiten einzeichnete. Kurze Zeit vor der Wende gründete sich ein von der Stasi äußerst misstrauisch beäugter Pfingstberg-Verein, dem es nach der Wende gelang, die für eine Restaurierung nötigen – erheblichen – Mittel zu aquirieren. Dadurch erstrahlt das Belvedere jetzt wieder in altem Glanz und ist einer der schönsten – in Potsdam so zahlreich erhaltenen Orte – an dem die Schönheit ferner Länder beschworen wird.

(Ein – zum maurischen Kabinett hervorragend passender – weiterer exotischer Ort Potsdams ist leider nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Unweit des Pfingstberges in der Bertinistraße am Jungfernsee befindet sich die Villa Gutmann, benannt nach einem jüdischen Bankier, Gründer der Deutschen Orientbank und Liebhaber arabischer Kunst. Dieser hatte in Damaskus eine hölzerne Wandvertäfelung aus dem 18. Jh. erworben und als „Arabicum“ in seine Villa einbauen lassen. Das wertvolle Kunstwerk überstand die Enteignung des Besitzers, den Krieg, 40 Jahre Sozialismus und die Wende. Leider unternehmen die neuen Besitzer – die das Anwesen zum Schnäppchenpreis von 650 000 Euro erwarben – nur wenig, um es zu erhalten und gar nichts, um das Kleinod des Arabicums einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen).
Deshalb kann man den Weg in die Bertinistraße getrost auslassen und wendet sich wieder nach Süden, vorbei am Jüdischen Friedhof mit seinen sehr alten, exotischen Grabsteinen und der im ägyptisierenden Stil errichteten Feierhalle zur Kolonie Alexandrowka, einen Ort, der das Aussehen des alten Russlands – das nach 70 Jahren Sozialismus im Ursprungsland verloren gegangen ist, in Potsdam bewahrt.
Die Alexandrowka geht zurück auf die Napoleonischen Kriege. Nach der Niederlage von 1806 gegen Napoleon musste sich Preußen an dessen Russlandfeldzug beteiligen und machte viele russische Gefangene, die in Preußen interniert wurden. Musikalisch Begabte unter ihnen gründeten einen Chor, dessen Darbietungen König Friedrich Wilhelm III. sehr entzückten. Als Preußen 1812 aus den Kriegshandlungen ausgestiegen war, hätten diese Kriegsgefangenen eigentlich frei kommen müssen, doch sorgte der russische Zar Alexander I. auf Wunsch Friedrich Wilhelms für deren Verbleib in Preußen. Nach dem Tod Alexanders 1825 hatte Friedrich Wilhelm den Wunsch, „ein bleibendes Denkmal der Erinnerung an die Bande der Freundschaft zwischen Mir und des Hochseeligen Kaisers Alexander“ zu schaffen. Er wählte dafür die Gründung einer russischen Kolonie in Potsdam, die mit den überlebenden 12 Sängern des Gefangenenchors besetzt und Kolonie Alexandrowka genannt werden sollte.

Der preußische Staat ließ ab 1826 auf seine Kosten die Kolonie im russischen Stil errichten. Die 12 Blockhäuser (und ein Aufseherhaus) wurden komplett möbliert, Gärten angelegt und die Bewohner jeder mit einer Kuh ausgestattet. Ganz konnte man jedoch auf preußische Sparsamkeit nicht verzichten. Die Holzhäuser geben nur vor, echte russische Blockhäuser zu sein – in Wirklichkeit sind es ganz normale (preiswerte) Fachwerbauten, die mit den im Sägewerk besonders billig zu habenden abgerundeten Endbrettern verkleidet wurden. Lediglich die Verkröpfung der – nur 50 cm langen – Eckbaumstämme führte man in massivem Material aus. An den Giebeln und den Fenstern brachte man russische Ornamentik an. Die Häuser gingen in das Eigentum der Sänger über, durften aber weder verkauft, verpachtet und verpfändet, jedoch an männliche Nachkommen vererbt werden.

Zur Vervollkommnung des Ensembles errichtete man auf dem nahegelegenen Kapellenberg 1829 in Massivbauweise mit fünf Kuppeln noch die russisch-orthodoxe Alexander-Newski-Gedächtniskirche in russisch/byzantinischem Stil. Neben der Kirche steht das vierzehnte Wohnhaus, das der aus Russland stammende königliche Lakai Tarnowsky bewohnte.



Außerhalb dieses Spaziergangs, auch außerhalb Potsdams – aber zu dessen Park- und Schlösserlandschaft gehörend – liegt die Marienquelle im Kidrontal. Sie befindet sich am Uferweg des Templiner Sees zwischen Potsdam und Caputh, kurz vor dem Ortseingang von Caputh. Hier in den Bergen der Potsdamer Heide wollte König Friedrich Wilhelm IV. seiner Jerusalembegeisterung Ausdruck verleihen. Die Templiner Quelle sollte von August Stüler nach dem Vorbild des Grabes der Maria im Kidrontal in Jerusalem gestaltet werden. Das Jerusalemer Mariengrab hatte nach Eroberung der Stadt durch die Kreuzritter um 1150 eine frühgotische Fassade erhalten. Die wie das Original in einer kleinen Senke liegende Nachbildung lehnt sich an das Vorbild stilistisch eng an. Das Typische der Architektur, die dreifache Einfassung des Eingangs durch zwei gestufte Spitzbogenblenden und eine Rechteckrahmung nahm Stüler vereinfachend auf – mit zwei auf Säulen ruhenden flachen Spitzbögen und einem rechteckigen Abschluss. Durch die Verwendung von Ziegeln anstelle von Kalkstein entsprach das Ganze jetzt mehr der norddeutschen Backsteinarchitektur. Vor kurzem wurde die Marienquelle renoviert und präsentiert nun wieder ihren eigenartigen Reiz, der durch die Verpflanzung orientalischer Architekturformen in die märkische Landschaft entsteht.